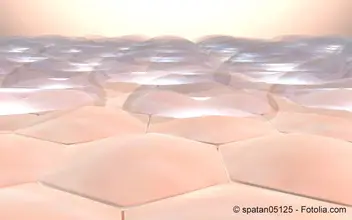Schon vor mehr als 20 Jahren konnte Professor Dr. Erika von Mutius (München) nachweisen, dass Kinder, die auf Bauerhöfen mit Kuhställen aufwachsen, deutlich weniger häufig an Asthma leiden als Stadtkinder.
Hygieneorientiert versus traditionell schmutzig
Diese Erkenntnisse werden von aktuelleren Untersuchungen bestätigt. Professor Dr. Tari Haahtela (Helsinki, Finnland) berichtete über Ergebnisse eines Vergleichs zweier Bevölkerungsgruppen in Karelien: eine Gruppe lebte auf der finnischen Seite mit eher westlichem, hygieneorientiertem Lebensstil, die andere auf russischem Territorium lebte traditionell und naturverbunden. So spielten finnische Kinder überwiegend drinnen, wurden für den Waldspaziergang wie Astronauten verpackt und kannten Gemüse hauptsächlich aus dem Supermarkt. Die Kinder im russischen Karelien spielten ohne Ausrüstung im Freien und aßen Gemüse direkt aus dem Gartenbeet.
Schmutz schützt vor Allergie
Die finnischen Forscher untersuchten in beiden Populationen Schulkinder von 7-16 Jahren auf Birkenpollen-Sensibilisierung und stellten fest, dass diese bei den finnischen Kindern fast dreimal höher war als bei den russischen. Ebenso war die Asthma- und die Heuschnupfen-Prävalenz im finnischen Karelien ebenfalls um ein Vielfaches höher.
Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass diese Differenz vermutlich auf der Prägung des Immunsystems bei den Kleinkindern durch unterschiedliche Noxen beruht. Um dies nachzuweisen, sammelten die Forscher in den Haushalten der beiden Bevölkerungsgruppen den Hausstaub. Und auch hier taten sich große Unterschiede auf: im Staub aus russischen Häusern fanden sich weit mehr und weit vielfältigere Bakterienspezies und Sporen als im Staub der finnischen Haushalte [1].
Biodiversivitäts-Hypothese
Diese Ergebnisse führten Haahtela und seine Kollegen zu der Biodiversitäts-Hypothese: Der Mensch bzw. sein Immunsystem steht in ständigem Kontakt mit seiner Umwelt und akquiriert (und beherbergt) durch Essen, Atmen und Anfassen ständig Mikroben. Diese bilden auf der Haut, auf den Atemwegen und vor allem im Darm ein Mikrobiom aus, dass seinerseits das Immunsystem beeinflusst. Je stärker der Kontakt zur Natur desto mehr bereichert sich das Mikrobiom. Und umso mehr setzt sich das Immunsystem mit den verschiedenen Noxen auseinander und wird so gestärkt – auch die Balance zwischen Abwehr und Toleranz [2].
Bauernhofstaub kann Stadtkinder schützen
Diese Biodiversitäts-Hypothese wird von den Ergebnissen einer finnisch-deutschen Studie gestützt, bei der die mikrobielle Zusammensetzung der Innenraumluft in den Wohnungen von Bauern- und Nichtbauernkindern in Zusammenhang mit Allergien und Asthma untersucht wurde [3]. Auch hier ergab sich: Je mehr die Zusammensetzung der Hausstaubmikrobiota dem des Bauernhausstaubs ähnelt, desto größer ist der kindliche Schutz vor Asthma. In dieser Studie stellte sich auch heraus, dass das Blut der Kinder, die zuhause den Asthma-protektiven Hausstaub eingeatmet hatten, deutlich weniger proinflammatorische Zytokine aufwies als das der Kontrollgruppen. Offenbar begünstigt der frühkindliche anhaltende Kontakt mit einer vielfältigen bakteriellen Umwelt die Entwicklung eines ausgewogenen Immunsystems und verhindert überschießende Reaktionen der immunologischen Abwehr [3].
Bakterienlysat reduziert Asthmanfälle
Da man jedoch nicht alle Kinder auf den Bauernhof bringen kann, müsste also der Bauernhof bzw. die Bauernhof-Mikrobiota zu den Stadtkindern kommen. In ersten Pilotstudien hat man dies schon versucht. Kindern unter drei Jahren, die unter häufigen Asthma-Anfällen litten, wurde sublingual ein Bakterienlysat auf der Basis ganzer inaktivierter Bakterien (MV130) oder Placebo verabreicht. Ergebnis: In der MV130-Gruppe wurde eine signifikant niedrigere Anzahl von Asthma-Attacken festgestellt als in der Placebogruppe. Zudem gingen in der Verumgruppe die Dauer der Anfälle, insgesamt die Symptome sowie der Verbrauch an Medikamenten zurück [4].
In einer anderen placebokontrollierten Untersuchung wurde Vorschulkindern ein Bakterienlysat (OM-85 BV)) oral gegeben und beobachtet, wie sich dies auf die Anzahl von Keuchattacken bei akuten Atemwegsinfektionen (ARTI) auswirkt. Tatsächlich reduzierte sich in der Verumgruppe signifikant die Häufigkeit und Dauer von Keuchanfällen bei Vorschulkindern mit ARTIs [5].