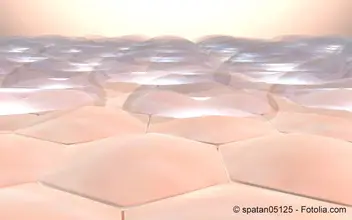Eine Diagnose setzt sich bekanntlich aus vielen Daten zusammen: Befunde (eigne und die, anderer Fachbereiche), Histologie, Fotos (aktuelle und früherer) Metadaten wie Alter und Geschlecht der Patienten u.v.a.m.
Alle diese Daten müssen auch unterschiedlich gewichtet werden. Letztlich setzt sich im Kopf des Dermatologen ein Bild sprich Diagnose zusammen. Wie gut genau dann diese Diagnose ausfällt, hängt wesentlich von der Erfahrung des einzelnen Dermatologen ab. Schwierig wird es aber dann , wenn es sich um seltene Erkrankungen handelt, bei der ein einzelner Dermatologe naturgemäß nur über wenig Erfahrung verfügt. Hier kann heutzutage Künstliche Intelligenz (KI) helfen. In Deep-Learning Algorithmen fließen sozusagen die Erfahrungen vieler Dermatologen ein. Wie treffsicher dann die KI-Diagnose ausfällt, davon ab, wie gut diese Algorithmen die Fakten und Erfahrungen zusammenführen.
Mehrstufiger Lernalgorithmus
Ein Forschungsteam um PD Dr. Tobias Lasser vom Munich Institute of Biomedical Engineering (MIBE) der Technischen Universität München (TUM) hat nun einen neuen Lernalgorithmus − FusionM4Net − entwickelt, der eine höhere durchschnittliche Diagnosegenauigkeit aufweist als bisherige Algorithmen. Neu ist bei FusionM4Net , dass ein multimodaler, mehrstufiger Prozess zur Datenzusammenführung verwendet wird:
„Multi-modal“: Mehrere Datenmodalitäten: Der Lernalgorithmus integriert drei verschiedene Datentypen: In der Klinik aufgenommene Fotos, mikroskopische Bilder der verdächtigen Hautläsion und Metadaten der Patienen.
„Multi-label“: Mehrere Hauterkrankungen: Die Forschenden trainierten den Algorithmus zur Unterscheidung fünf verschiedener Kategorien von Hautveränderungen.
„Multi-stage“: Mehrere Stufen: Der neue Algorithmus fügt zunächst die verfügbaren Bilddaten und dann die Metadaten des Patienten zusammen. Dieser zweistufige Prozess ermöglicht eine Gewichtung der Bilddaten und Metadaten beim Entscheidungsprozess des Algorithmus. Dadurch unterscheidet sich FusionM4Net deutlich von bisherigen Algorithmen auf diesem Gebiet, die alle Daten auf einmal zusammenführen.
Hohe Diagnosegenauigkeit für FusionM4Net
Um die Diagnosegenauigkeit eines Algorithmus zu bewerten, kann er mit der besten vorhandenen Klassifizierung für den verwendeten Datensatz verglichen werden, für die der Wert 100 Prozent angesetzt wird. Die durchschnittliche Diagnosegenauigkeit von FusionM4Net verbesserte sich durch den mehrstufigen Prozess auf 78,5 Prozent und übertraf damit alle weiteren Algorithmen, mit denen er verglichen wurde.
Auf dem Weg zur klinischen Anwendung
Um die Reproduzierbarkeit zu gewährleisten, wurde zum Trainieren des Algorithmus ein öffentlich zugänglicher Datensatz verwendet. Datensätze sind in der Dermatologie jedoch nicht überall standardisiert. Je nach Klinik können unterschiedliche Arten von Bildern und Patienteninformationen vorliegen. Daher muss der Algorithmus für den tatsächlichen klinischen Einsatz mit den Daten umgehen können, die in der jeweiligen Klinik verfügbar sind.
Gemeinsam mit den Dermatologen der LMU München arbeitet das Forschungsteam intensiv daran, den Algorithmus für die zukünftige klinische Routine einsatzfähig zu machen. Dafür integriert das Team aktuell zahlreiche Datensätze, die für diese Klinik standardisiert wurden.
Die Forscher erhoffen sich vom klinischen Einsatz solcher Algorithmus beispielsweise, dass die Diagnosesicherheit steigt oder, dass seltene Krankheiten auch von weniger erfahrenen Ärzten erkannt werden.