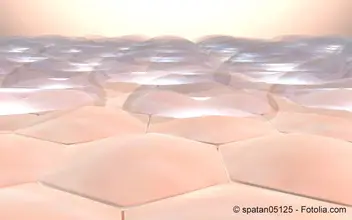Bei den dermatologisch relevanten Berufskrankheiten (BK) sind zwei Gruppen bedeutsam, die zusammengenommen die Berufskrankheitenstatistik anführen: die Berufskrankheit (BK) 5101 („schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen“) und die BK 5103 („Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische Keratosen der Haut“).
Für BK „Schwere“ wichtig
Unter BK 5101 fallen Läsionen wie Hautrisse, Entzündungen, Bläschenbildung, Schmerzen, wie sie besonders bei Arbeitnehmern in Gesundheitsberufen, im Friseurgewerbe, in der Metallindustrie, in Reinigungsbetrieben oder der Gastronomie auftreten. Ob die Dermatose, die meist an den Händen als Ekzem auftreten, als Berufskrankheit anerkannt wird, hängt mit der Definition des Begriffs „schwere Hauterkrankung “ zusammen.
Die „Schwere“ hat mit der Dauer der Erkrankung zu tun (d.h. mehr als sechs Monate) sowie mit dem klinischen Bild und den Symptomen, der Ausdehnung und dem Ort des Befalls (Streuphänomene, großflächig oder generell). Ebenfalls ein Faktor ist das Ansprechen auf die Behandlung. Therapieresistenz, schlechte Heilungstendenz, teilstationäre oder stationäre Behandlung – all fließt in die Beurteilung „schwere Hauterkrankung“ ein.
Unterlassungszwang entfällt
Für die Anerkennung als Berufserkrankung war bisher das Aufgeben des Berufes („Unterlassungszwang“) eine Voraussetzung. Diese Hürde fällt nun mit der Änderung des Berufskrankheitenrechts zum 1.1.2021 weg.
Kostenanstieg mit zunehmender BK-Häufigkeit
Mit der Abschaffung des Unterlassungszwangs ist mit einem großen Anstieg der Anerkennungszahlen zu rechnen. Der Anteil der Anerkennungen der fast 20.000 gemeldeten BK 5101-Verdachtsfälle lag im Jahr 2019 mit nur 383 Fällen unter zwei Prozent. Bei den etwa 7.500 BK-Meldungen zu Hautkrebsarten und ihren Vorstufen waren es mit 3.766 Anerkennungen dagegen über 50 Prozent.
Wenn jetzt die Anerkennungsquote für die BK 5101 in die Tausende geht, wird sich das ganz erheblich auf die dermatologische Versorgung auswirken, da in all diesen Fällen dann die gesetzliche Unfallversicherung dauerhaft zuständig für die Behandlung ist, befürchten Experten. Das heißt auch, dass die jeweiligen Berufsgenossenschaften oder der Unfallkasse erhebliche Kosten – von therapeutischen Maßnahmen bis hin zu möglichen Rentenansprüchen – auf sich zukommen sehen.
Therapieverzögerung bei BK-Verdacht?
Dadurch könnte sich eine Therapielücke auftun: Denn wenn jetzt eine „schwere oder rückfällige Hauterkrankung“ festgestellt wird, ist ein BK-Feststellungsverfahren einzuleiten, das Monate dauern kann, bis die Berufskrankheit anerkannt wird, die Kostenübernahme durch die Unfallkasse vorliegt und die Therapie beginnt.
Hautarztverfahren gewährleistet Versorgung
Doch hier wurde bereits nachjustiert: Bereits bei dem begründeten Verdacht einer berufsbedingten Hauterkrankung wird bei dem Unfallversicherungsträger ein Behandlungsauftrag beantragt, damit Therapie und Präventionsmaßnahmen starten können. Um dies zu gewährleisten, wird das gemeinsame Hautarztverfahren als effektives Präventionsverfahren auch bei Berufskrankheitenanzeigen fortgesetzt. Dieses von Ärztinnen/Ärzten und Unfallversicherungsträgern vereinbarte Verfahren dient der Früherfassung berufsbedingter Hauterkrankungen. Ziel dieses „Frühmeldeverfahrens ist es schnell und effektiv geeignete Maßnahmen ergreifen, um einer (chronischen) Berufskrankheit vorzubeugen – und um trotzdem den Betroffenen zu ermöglichen, ihre berufliche Tätigkeit fortzusetzen.