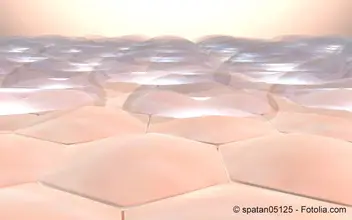Hautbiopsien gehören zu den wichtigsten und vor allem einfachsten Diagnosetechniken in dermatologischen und allgemeinmedizinischen Praxen. Der diagnostische Grad an Informationen könnte jedoch noch erheblich gesteigert werden, wenn bestimmte Rahmenbedingungen eingehalten werden. Nicht selten führen fehlerhaft durchgeführte Biopsien zu Verzögerungen bei der Diagnose und in Folge auch zu einer Verzögerung der therapeutischen Maßnahmen.
Welche Faktoren sind für eine aussagekräftige Hautbiopsie entscheidend?
Für ein effizientes Ergebnis einer Hautbiopsie sind das optimale Entnahmeareal, die Entnahmetechnik, der Zeitpunkt der Biopsie, die Menge des entnommen Gewebes und deren Handhabung sowie dessen Verarbeitungstechnik entscheidend. Australische Forscher fassten zusammen, was bei Biopsien und Biopsaten beachtet werden muss, um in der Praxis den größtmöglichen diagnostische Nutzen zu erreichen. Die Ergebnisse ihrer Analyse publizierten sie im Australien Journal of General Practice [1].
Biopsie-Techniken
Zur Diagnose von dermatologischen Veränderungen ist eine Biopsie oft das Mittel der Wahl. Zu den am häufigsten angewendeten Biopsie-Techniken gehören Stanzen, Schälen und Schneiden. Jede Technik hat ihre Vor- und Nachteile. Bei der Auswahl kommt es immer auf die Hautveränderung an, die beurteilt werden soll:
- Bei den meisten entzündlichen Hautläsionen wird die Stanzbiopsie empfohlen. Damit kann das entnommene Gewebestück von der Epidermis bis hinunter in das obere subkutikuläre Fettgewebe beurteilt werden.
- Bei oberflächlichen, superfizialen Läsionen, bei denen die Pathologie auf die Epidermis begrenzt ist (beispielsweise bei Basaliomen und Spinaliomen), werden oft Schäl-Biopsie-Verfahren bevorzugt.
- Eine Exzisionsbiopsie ist eine geeignete Technik bei Verdacht auf Melanome, subkutane oder tiefe Hauttumoren sowie tiefe Entzündungsprozesse.
- Bei heterogenpigmentierten, melanozytären Veränderungen ist eine vollständige Entfernung mittels Exzisionsbiopsie zu empfehlen.
Zeitpunkt der Biopsie und Auswahl der Entnahmestelle
Zeitpunkt der Biopsie und Auswahl der Entnahmestelle sind je nach Läsion unterschiedlich. Besonderheiten sind insbesondere bei inflammatorischen Hautveränderungen zu beachten. Im Allgemeinen sollte die Gewebsentnahme an Läsionen mit der stärksten primären entzündlichen Veränderung erfolgen. Veränderungen zu Beginn einer Entzündung könnten nur unspezifische Merkmale aufweisen. Ganz anders sieht es hingegen bei bullösen und pustulösen Läsionen sowie bei Verdacht auf eine Vaskulitis aus. In diesen Fällen liefern frühzeitige Läsionen innerhalb von 48 Stunden nach Beginn der Veränderung die spezifischsten Diagnose-Merkmale. Biopsien von Geweben mit Verkrustungen, Narbenbildung und Infektionen sowie bei kürzlich vorbehandelten, traumatisierten und exkoriierten Läsionen sollten aufgrund einer zu geringen histopatholgischen Aussagekraft vermieden werden.
Besonderheiten bei der Gewebe-Entfernung
Läsionen können je nach Größe vollständig oder auch nur teilweise entfernt werden. Bei kleineren Veränderungen mit einer Größe von weniger als 4 mm ist eine komplette Beseitigung mittels Stanzbiopsie anzuraten. Des Weiteren sind folgende Vorgehensweisen sinnvoll:
- Bei großen entzündlichen Läsionen empfiehlt sich die Entnahme aus einem randständigen Bezirk einer sich ausdehnenden Läsion, aus dem Bereich mit den größten Farbunterschieden oder aus dem Teil der Läsion, der am stärksten verdickt ist.
- Annuläre Plaques sollten am erhabensten Rand der Läsion biopsiert werden, makulöse und papulöse Läsionen im Zentrum der Veränderung.
- Bei einem Ulkus oder ulzerösen Veränderungen ist es erforderlich, einen Teil des gesunden bzw. unveränderten Gewebes mit zu biopsieren (vorrangig als Inzisionsbiopsie). Gewebe aus dem Ulkusbett selbst liefern oft nur unspezifische Befunde.
- Bei vesikobullösen Störungen sollte vorzugsweise ein kleines intaktes Vesikel oder aber ein randständiger Bereich mit intakter Oberfläche gewählt werden. Zusätzliche Stanzbiopsien von periläsionalem Gewebe sind für die direkte Immunfluoreszenzdiagnostik zu empfehlen.
- Bei polymorphen Hautläsionen sind multiple Biopsien von Arealen mit unterschiedlicher Morphologie sinnvoll.
- Bei tiefen dermalen Tumoren sowie Melanom-Verdacht wird eine Exzisionsbiopsie der gesamten Läsion mit 2 mm Sicherheitsabstand bis ins unveränderte Areal empfohlen. Von einer Teilbiopsie melanozytärer Läsionen wird dringend abgeraten.
- Inzisionsbiopsien mit einer Teilentfernung des Gewebes eignen sich beispielsweise für tief infiltrierende Entzündungen, Vaskulitiden der mittelgroßen Gefäße, Porokeratosen und kutane Lymphome.
- Einige Dermatosen wie petechialer Ausschlag, Alopezie, kutaner oder diskoider Lupus oder Purpura erfordern Biopsate für weitere Tests.
Sorgfältige Anforderung sichert eine optimale Histopathologie
Nach der Biopsie ist die weitere Handhabung für einen effizienten diagnostischen Befund entscheidend. Zunächst einmal sollte das Anfrageformular detailliert und vollständig ausgefüllt sein. Oft werden Punkte übersehen oder für nicht wichtig erachtet. Dabei sind klinische Informationen und eine genaue makroskopische Beschreibung der Hautläsion für den Dermatopathologen unerlässlich. Ein korrekt ausgefülltes Anfrageformular hilft ihm bei seiner Interpretation, damit die Diagnose am Ende auch mit dem klinischen Bild übereinstimmt. So können Verwirrungen und irrelevante Differenzialdiagnosen, die nicht mit dem klinischen Eindruck korrelieren, verhindert werden.
Fotos der Läsion helfen dem Pathologen
Studien haben gezeigt, dass Konzentration und Gewissenhaftigkeit beim Ausfüllen des Pathologieanforderungsformulars zu höheren Korrektheitsraten bei der Diagnose führen. Ebenfalls sollten zusätzliche gewünschte Tests wie die direkte Immunfluoreszenz (DIF) oder mikrobiologische Kulturen angegeben werden. Zudem ist es sehr hilfreich, neben dem Biopsat digitale Fotos der Läsion(en) als Anhang mit zu übermitteln.
Transport der Gewebeproben
Ein unsachgemäßer Umgang und Transport von Gewebeproben kann die Genauigkeit der histopathologischen Interpretation und Diagnose erheblich beeinträchtigen. Die Proben sollten sorgfältig behandelt werden, um Quetschverletzungen zu minimieren. Jede Gewebeprobe sollte für den angeforderten Test in das richtige Transportmedium gelegt und transportiert werden (oft in 10% gepufferter Formalinlösung). Falsche Transportmedien können wie Verzögerungen bei der Probenentnahme und -verarbeitung zu einer verminderten diagnostischen Genauigkeit führen.
Kosmetische Gesichtspunkte beachten
Wenn möglich, sollten Biopsien an kosmetisch ungünstigen Stellen vermieden werden. Dazu gehören insbesondere Gesicht und Dekolleté, aber auch schlecht durchblutete Hautareale sowie Gebiete mit hoher mechanischer Beanspruchung oder mit erhöhter Infektionsgefahr. An Beinen und Füßen könnten beispielsweise Veränderungen der venösen Situation die Heilung verzögern - vor allem bei älteren Menschen, Diabetikern und Patienten mit vaskulärer Insuffizienz. Achselhöhlen und Leistengegend sind besonders prädisponierte Stellen für Infektionen. Für Biopsate geeignet sind Oberschenkel, Bauch, Rücken und Arme.