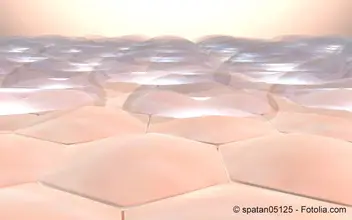Viele Mütter kennen es: Windeldermatitis beim Baby. Sie entsteht durch das Zusammenspiel von feuchtwarmem Klima im Okklusionsbereich, Druck, Reibung und der Kontakt mit dem Stuhl und dem Urin. Die Epidermis quillt auf, die Hautbarriere wird durchlässiger, kleine Verletzungen können dazu kommen – Eintrittspforten für Infektionen zum Beispiel durch Staphylococcus aureus und Hefepilze. In etwa sechs Prozent der Fälle kommt es zu schweren Superinfektionen mit Papeln, Pusteln und starken Schmerzen.
Windelpausen helfen
In den meisten Fällen lässt sich die Windeldermatitis mit Windelpausen, häufigem Windelwechseln sowie milde Reinigungs- und Pflegemaßnahmen wieder in den Griff bekommen.
Inkontinenz-assoziierte Dermatitis statt Windeldermatitis
Doch wie sieht es bei den Erwachsenen aus? Hier werden die Entzündungen im Anogenitalbereich Inkontinenz-assoziierte Dermatitis (IAD) genannt. Grund für den Begriffswechsel ist, den Betroffenen, für die das Windeltragen so schon belastend ist, weitere Beschämung zu ersparen.
Fast jeder Vierte über 60 Jahren ist inkontinent
Und es gibt nicht wenige, die von IAD betroffen sein könnten: Nach Angaben der Stiftung Gesundheitswissen leiden etwa 13 von 100 Erwachsenen an Harninkontinenz, bei den über 60-Jährigen sogar 23 von 100. Und über 60 Prozent der zu Hause betreuten Pflegebedürftigen sind inkontinent – in den Pflegeheimen liegt die Zahl der Inkontinenten noch höher. Sie alle haben ein hohes Risiko für eine IAD.
Kontinenz fördern, Inkontinenz kompensieren
Um die Inkontinenz-assoziierte Dermatitis gut zu managen bzw. ihr vorzubeugen, werden im pflegeprofessionellen Bereich zwei Handlungsstränge verfolgt: die Förderung der Kontinenz und die Kompensation der Inkontinenz, heißt es in der Pressemitteilung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG).
Wichtig: Inkontinenz-Anamnese
Am Anfang sollte eine gründliche pflegerische Inkontinenzanamnese stehen, bei der neben den subjektiv empfundenen Belastungen der betroffenen Person auch Dauer, Ernährungs- und Trinkgewohnheiten sowie Inkontinenzepisoden erfasst werden. Des Weiteren sollte die Beschaffenheit des Stuhls und Urins geprüft sowie eine Inspektion der Haut vor allem im Genital- und Analbereich erfolgen. Zum Fördern der Kontinenz gehört – wenn das der Zustand der Person zulässt – auch eine Förderung der Mobilität. Neben Blasen- und Beckenbodentraining können auch praktische Maßnahmen wie die Nähe zu einer Toilette, die Toilettensitzerhöhung, Haltegriffe etc. helfen, auf die Windeln wenigstens zweitweise zu verzichten. Angepasste Kleidung, die auch selbständig schnell und leicht geöffnet werden kann, ist ebenfalls hilfreich.
Häufig Windeln wechseln, Langzeithautschutz
Und es gibt außer den Windeln und Vorlagen noch weitere Hilfsmittel zur Kompensation der Inkontinenz wie Blasenkatheter und Kondomurinal, Analtampons oder Fäkalkollektoren. Die Behandlungs- und Pflegeempfehlungen bei IAD unterscheiden sich prinzipiell nicht von denen, die die DDG für Kinder. Das heißt unter anderem
- Windelfreie Zeiten tagsüber
- Häufiges Windelwechseln, etwa in einem Intervall von zwei bis drei Stunden
- Schutz- und Regenerationspräparate in der Windelzone anwenden wie z. B. zinkhaltige Externa und Langzeithautschutz-Cremes
- Hautreinigen mit Wasser und milden Seifen; ölhaltige Einmaltücher zur Reinigung von Stuhlverschmutzung
- Feuchte Umschläge oder Sitzbäder mit Gerbstoffen bei offenen Stellen an der Haut
- Einmalwindeln mit absorbierenden Gelen verwenden