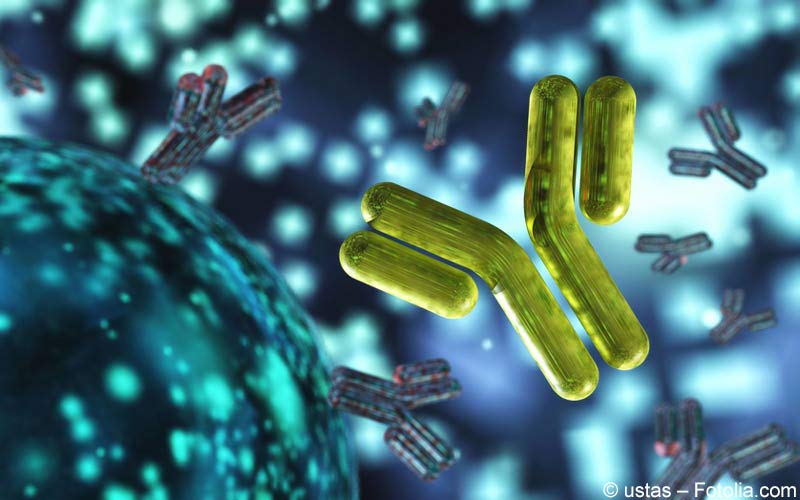
Hintergrund
Typ-1-Diabetes (T1D) ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die zur Zerstörung von insulinproduzierenden Beta-Zellen und zur Abhängigkeit von exogenem Insulin für das Überleben führt. Durch einige Immunbehandlungen konnte die Verschlechterung der Insulinproduktion bei Patienten mit T1D verzögert werden.
Vielversprechend zeigten sich Fc-Rezeptor-nichtbindende anti-CD3 Antikörper, wie Teplizumab. In mehreren Studien mit Patienten mit T1D reduzierte eine Behandlung mit Teplizumab den Verlust der Beta-Zell-Funktion, auch sieben Jahre nach der Diagnose. Der Antikörper modifiziert CD8+ T-Lymphozyten, die vermutlich Beta-Zellen angreifen. Ob eine Intervention zum Zeitpunkt des Auftretens von Autoantikörpern oder einer gestörten Glukosetoleranz das Fortschreiten zu T1D beeinflussen kann, ist unbekannt.
Zielsetzung
Ein wissenschaftliches Team um Kevan C. Herold von den Departments of Immunobiology and Internal Medicine an der Yale University in New Haven, USA, untersuchte im Rahmen einer randomisierten, plazebokontrollierten, doppelt verblindeten Phase-II-Studie, ob die Behandlung mit Teplizumab das Auftreten von klinische manifestiertem T1D bei Risikopersonen verhindern oder verzögern kann. Die Studienergebnisse wurden im New England Journal of Medicine publiziert [1].
Methodik
In die Studie wurden Personen mit Verwandten mit T1D, bei denen selbst noch kein Diabetes, aber ein hohes Risiko für die Entwicklung der Erkrankung vorlag, eingeschlossen. Die Probanden wurden nach dem Zufallsprinzip einer 14-tägigen Behandlung mit Teplizumab oder Plazebo zugeteilt. Das Fortschreiten zum klinisch manifesten T1D wurde in Abständen von sechs Monaten anhand oraler Glukosetoleranztests überwacht.
Ergebnisse
Insgesamt 76 Teilnehmer (55 [72%] Personen ≤ 18 Jahre) wurden randomisiert. 44 Personen wurden der Teplizumabgruppe und 32 der Plazebogruppe zugeteilt. Die mediane Zeit bis zur Diagnose von T1D betrug 48,4 Monate in der Teplizumabgruppe und 24,4 Monate in der Plazebogruppe. Die Krankheit wurde bei 19 (43%) Teilnehmern, die Teplizumab erhalten hatten, und bei 23 (72%) Teilnehmern, die Plazebo erhalten hatten, diagnostiziert. Die Hazard Ratio für die Diagnose von T1D (Teplizumab vs. Plazebo) betrug 0,41 (95%-Konfidenzintervall 0,22 bis 0,78; P=0,006 nach adjustiertem Cox-Proportional-Hazard-Modell).
Die Diagnoserate für Diabetes pro Jahr betrug in der Teplizumabgruppe 14,9% und in der Plazebogruppe 35,9%. Als erwartete unerwünschte Ereignisse wurden Hautausschlag und vorübergehende Lymphopenie beobachtet. TIGIT+KLRG1+CD8+ T-Zellen traten bei Probanden in der Teplizumabgruppe häufiger auf als in der Plazebogruppe. Bei Teilnehmern, die HLA-DR3-negativ, HLA-DR4-positiv oder Anti-Zink-Transporter-8-Antikörper-negativ waren, wurde in der Teplizumabgruppe weniger häufig ein Diabetes diagnostiziert als in der Plazebogruppe.
Fazit
Teplizumab verzögerte das Fortschreiten zu klinischem T1D bei Hochrisikoteilnehmern der Studie. Möglicherweise könnte eine wiederholte Gabe einen größeren Nutzen erbringen, eine größere Anzahl an Personen mit aktiver Krankheit ansprechen oder eine Verlängerung der therapeutischen Wirkung erzielen. Diese Strategie wurde in dieser Studie nicht getestet, betonen die Autoren.
Als Einschränkungen der Studie geben sie die geringe Zahl an Probanden und eine niedrige statistische Power an. Es sei unklar, inwieweit die Ergebnisse auf Personen mit anderem Risikoprofil und anderem ethnischen Hintergrund übertragbar seien. Die Entwicklung von Antikörpern gegen Teplizumab wurde nicht untersucht.
Die Studie ist unter der Nummer NCT01030861 bei ClinicalTrials.gov registriert und wurde von den National Institutes of Health und anderen nicht-kommerziellen Einrichtungen, sowie von MacroGenics gefördert.









