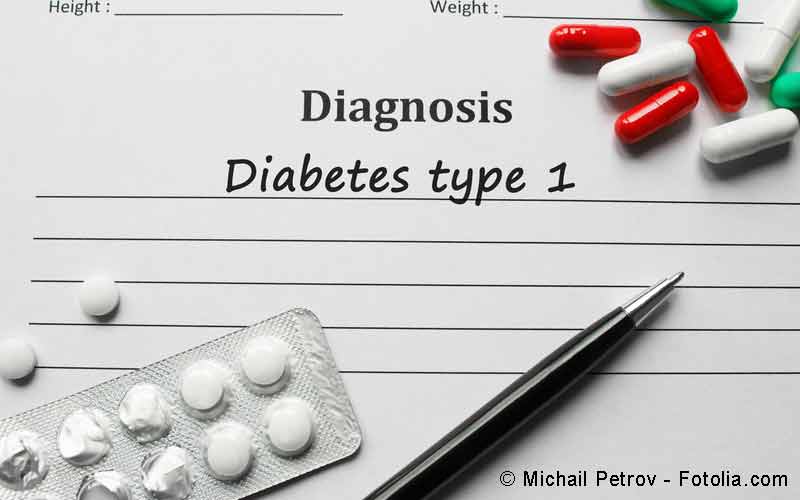
Allein in Deutschland leben 32.000 Kinder und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1. Viele von ihnen haben eine sogenannte Insulinpumpe. Diese besteht aus der Pumpe, einem Schlauch und einer Nadel, die unter der Haut liegt. Ähnlich der Bauchspeicheldrüse gibt die Insulinpumpe regelmäßig automatisch Insulin in den Körper ab. Sie simuliert so bis zu einem gewissen Maß den natürlichen Insulinrhythmus des Körpers und erspart das tägliche Spritzen von Insulin mittels Spritze oder Pen.
Diese Methode der Diabetestherapie bei Typ 1-Diabetes gilt seit einigen Jahren als vorteilhaft - besonders bei jungen Patientinnen und Patienten. In früheren Studien konnte gezeigt werden, dass weniger akute Komplikationen auftreten und der HbA1c niedriger ist. Aber nicht nur das. Für die jungen Betroffenen bedeutet die Pumpe auch eine verbesserte Lebensqualität und bringt psychosoziale Vorteile mit sich. Eine große Frage bei dieser Art der Dauertherapie war bisher aber, zu welchem Zeitpunkt und wie lange nach der Erstdiagnose die Insulinpumpe eingesetzt werden sollte. Eine Studie des wissenschaftlichen Teams um den Kinder-Endokrinologen und -Diabetologen Clemens Kamrath vom Universitätsklinikum Gießen hat sich damit nun näher befasst. Die Daten wurden im Journal «Lancet Child Adolescent Health» veröffentlicht.
Zielsetzung
Es ist bereits seit Längerem bekannt, dass mit Insulinpumpen bei Typ 1-Diabetes bessere Ergebnisse erzielt werden können als mit klassischen Therapien. Der optimale Zeitpunkt, ab wann derartige Systeme eingesetzt werden sollten, wird jedoch debattiert. In ihrer Studie wollte das Team aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verschiedener Forschungseinrichtungen in Deutschland genau diese Frage untersuchen und setzte sich zum Ziel, zu vergleichen, ob ein früher Pumpeneinsatz (innerhalb der ersten sechs Monate nach Diagnose) vorteilhafter ist als ein späterer Pumpeneinsatz (zwei bis drei Jahre nach Diagnose).
Methodik
Für die Studie wurden Daten aus vielen Diabeteszentren in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg herangezogen. Diese Daten gehören zu prospektiven Follow-up Registern wie beispielsweise der Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation, kurz DPV. Diese Daten stammen aus 501 Zentren und umfassen etwa 588.860 Patientinnen und Patienten.
Einschlusskriterien
Aus diesen Datensätzen wurden solche ausgewählt, bei denen die Patientinnen und Patienten zum Zeitpunkt der Erstdiagnose eines Typ-1-Diabetes zwischen sechs Monaten und fünfzehn Jahren alt waren. Die Daten stammten aus den Jahren 2004 bis 2014. Alle Patientinnen und Patienten mussten mindestens ein Jahr lang mittels Insulinpumpe behandelt und die Insulinpumpentherapie entweder innerhalb der ersten sechs Monate nach Diagnosestellung (frühe Gruppe) oder im zweiten oder dritten Jahr (späte Gruppe) begonnen worden sein. Ausgeschlossen wurden die Patientinnen und Patienten, die ihre Insulinpumpe zwischen sechs und zwölf Monaten nach Diagnose erhielten, die Pumpentherapie im ersten Behandlungsjahr unterbrachen oder zu denen keine Daten der Erstdiagnose vorhanden waren.
Klinische Outcome-Parameter
Um zu evaluieren, wie sich ein früher und ein später Einsatz einer Insulinpumpe in der Therapie auswirken, wurden verschiedene klinische Parameter gewählt, wie beispielsweise der HbA1c-Wert, Häufigkeit schwerer Hypoglykämien und der Blutdruck.
Analysiert wurde vor allem der Vergleich zwischen der frühen und der späten Gruppe hinsichtlich der verschiedenen klinischen Outcome-Parameter.
Alle Modelle wurden zusätzlich auch mit gruppierte Daten durchgeführt, zum Beispiel bezogen auf das Alter, Geschlecht, Jahr der Diagnose und die Diabetesdauer.
Ergebnisse
Aus allen Datensätzen der Registerdatenbanken erfüllten 8.332 Patientinnen und Patienten aus insgesamt 311 Diabeteszentren die Einschlusskriterien. Es waren 4.160 (49,9%) davonmännlich und 4.172 (50,1%) weiblich. Das Durchschnittsalter bei Diagnose lag bei 6,1 Jahren (IQR 3,2-9,8) und 13,9 Jahren (IQR 10,7-17,0) während der Follow-ups. Alle Patientinnen und Patienten entwickelten akute Komplikationen durch ihre Diabeteserkrankung. Einen Migrationshintergrund hatten 19,0% der Patientinnen und Patienten (1.565).
Bei insgesamt 98% der Patientinnen und Patienten waren vollständige Daten zum HbA1c, dem systolischen und diastolischen Blutdruck, den täglichen Insulindosen und dem BMI dokumentiert. Lipidwerte hingegen waren nicht immer vollständig vorhanden, sie fehlten bei 27% bis 35% der Datensätze.
Die mediane Erkrankungsdauer lag während der Follow-ups bei 6,7 Jahren in beiden Gruppen mit IQR 5,1-8,7 in der frühen Gruppe und 5,0-8,7 in der späten Gruppe. Es wurden 4.004 (48,1%) der Patientinnen und Patienten basierend auf dem Zeitpunkt der ersten Insulinpumpentherapie in die frühe Gruppe einsortiert, 4.328 (51,9%) in die späte Gruppe. Patientinnen und Patienten, die früh mit Insulinpumpen behandelt wurden, waren bei der Diagnose signifikant jünger, hatten eine kürzere bisherige Erkrankungsdauer, einen höheren Index sozioökonomischer Deprivation, waren öfter männlich und wiesen gehäufter einen Migrationshintergrund auf.
Einfluss auf den Blutzucker
Blutzuckerwerte unterschieden sich signifikant zwischen der frühen und der späten Gruppe (p=0,0006): Während der HbA1c-Wert in der frühen Gruppe bei 7,9% (95%-KI 7,8-7,9) bzw. 62,6 mmol/mol (95%-KI 62,1-63,2) lag, war er in der späten Gruppe bei 8,0% (95%-KI 8,0-8,1) bzw. 64,1mmol/mol (95%-KI 63,6-64,6). Auch der Anteil der Patientinnen und Patienten mit adjustierten HbA1c-Werten kleiner als der Zielwert von 7,5% (<58 mmol/mol) war mit einem p-Wert von 0,0043 signifikant höher in der frühen Gruppe als in der späten Gruppe (OR=1,22; 95%-KI 1,06-1,39). Bei einem HbA1c-Wert <7,0% verschwand dieser Effekt jedoch (p=0,14). Ebenso verhielt es sich, wurde die Insulinpumpentherapie abgebrochen: Auch hier waren die Unterschiede mit p=0,15 nicht mehr signifikant.
Schwere Komplikationen
Auch in anderen Bereichen bestanden signifikante Unterschiede zwischen der frühen und der späten Gruppe. Patientinnen und Patienten mit früher Insulinpumpe mussten signifikant seltener hospitalisiert werden (IRR=0,86; 95%-KI 0,78-0,94; p=0,0016), hatten weniger jährliche Krankenhaustage (IRR=0,71; 95%-KI 0,68-0,73; p<0,0001) und fielen seltener in ein gefährliches Koma aufgrund starker Hypoglykämie (IRR=0,44; 95%-KI 0,24-0,79; p=0,0064). Auch die Wahrscheinlichkeit für hypoglykämisches Koma generell war in der frühen Gruppe signifikant niedriger (IRR=0,44; 95%-KI 0,24-0,79; p=0,0064). Die geschätzte Häufigkeit schwerer Hypoglykämien an sich unterschied sich jedoch nicht signifikant zwischen den beiden Gruppen (IRR=0,86; 95%-KI 0,59-1,32; p=0,55). Ebenso verhielt es sich mit der diabetischen Ketoazidose (p=0,080).
Positive kardiovaskuläre Effekte
Blutdruckwerte und Cholesterinkonzentrationen sind zwei wichtige Parameter, wenn das kardiovaskuläre Risiko von Typ-1-Diabetes Patientinnen und Patienten abgeschätzt werden soll. Der bereits in anderen Bereichen beobachtete signifikante Unterschied zwischen der frühen und der späten Gruppe setze sich auch hier fort.
Der systolische Blutdruck lag mit 117,6 mmHg (95%-KI 117,2-117,9) in der frühen Gruppe versus 118,5 mmHg (95%-KI 118,2-118,9) in der späten Gruppe signifikant niedriger bei den Patientinnen und Patienten, die frühzeitig mit einer Insulinpumpe versorgt wurden (p=0,0007). Auch das HDL-Cholesterol lag mit 62,8 mg/dL (95%-KI 62,2-63,5) in der frühen Gruppe signfikant niedriger (p<0,0001) als in der späten Gruppe mit 60,6mg/dL (95%-KI 60,0-61,2).
Für andere Werte wie den diastolischen Blutdruck, die LDL-Konzentration, non-HDL-Cholesterol, Triglyzeride und BMI konnten überwiegend keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden mit der Ausnahme älterer Kinder. Waren sie zum Zeitpunkt der Diagnose älter als 10 Jahre alt und erhielten frühzeitig eine Insulinpumpe, unterschied sich ihr BMI signifikant von der gleichen Subgruppe in der späten Gruppe (p=0,034). Ein früher Insulinpumpeneinsatz war somit nicht mit einer Gewichtszunahme verbunden.
Fazit
Die Datenanalyse zeigt eindrücklich, dass es vorteilhaft sein kann, Kinder und Jugendliche möglichst früh nach der Diabetesdiagnose mittels Insulinpumpe zu behandeln. Ihre Behandlung ist mit signifikant niedrigeren HbA1c-Werten assoziiert und mehr Patientinnen und Patienten erreichen den Zielwert von weniger als 7,5% (<58 mmol/mol) bei selteneren schweren hypoglykämischen Entgleisungen, Hospitalisierungen und Krankenhaustagen. Gleichzeitig scheint sich ihr kardiovaskuläres Risikoprofil dadurch verbessern zu lassen. „Der frühe Einsatz einer Insulinpumpe ist also mit keiner Gewichtszunahme verbunden“, so der Studienautor Clemens Kamrath. „Insgesamt liefern unsere Ergebnisse klare Hinweise, dass ein früher Insulinpumpen-Einsatz bei Kindern mit Typ-1-Diabetes zu besseren Behandlungsergebnissen führt“, sagt auch Thomas Kapellen vom Universitätsklinikum Leipzig.
Für Betroffene hat das praktische Auswirkungen, denn: „So kann die Insulinzufuhr insbesondere bei jungen Kindern besser und komfortabler gesteuert werden als mit mehrfach täglichen Injektionen, die häufig mit einer Hemmschwelle verbunden sind“, ergänzt Kamrath. In weiteren Studien müssen die Ergebnisse nun weiter detailliert werden.









