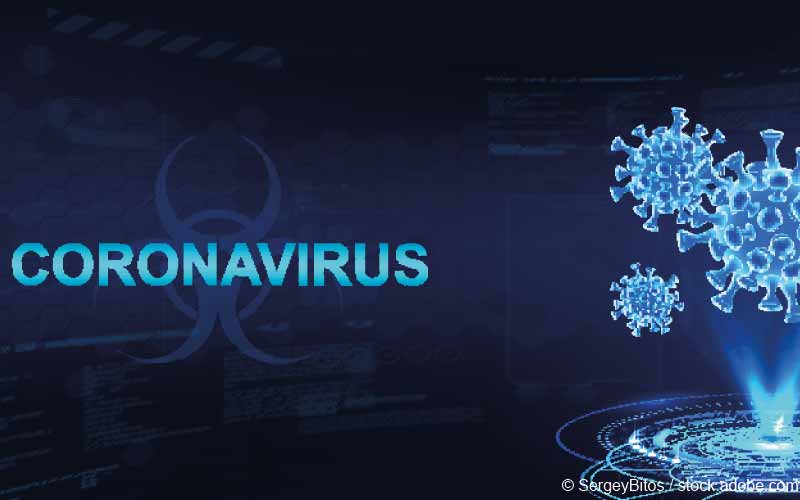
Unter Federführung von Dr. N. Giesen haben die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) und die Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH) mit ihren infektiologischen Arbeitsgemeinschaften eine Stellungnahme "Prolongierte Virusausscheidung („Shedding“) von SARS-CoV-2 bei Patienten mit Krebserkrankungen: Implikationen für Hygienemanagement, Diagnostik und Therapie" erarbeitet.
Zusammenfassung
- Auch wenn, aufgrund der noch unvollständigen Datenlage, Vorsicht geboten ist, ist eine prolongierte Ausscheidung von SARS-CoV-2 bei immunsupprimierten Patienten, vor allem bei B-Zell-Dysfunktion, wiederholt zu beobachten.
- Ein entsprechendes Monitoring dieser Patienten wird deshalb als sinnvoll erachtet.
- Bei Nachweis von SARS-CoV-2 RNA sollte eine Infektiosität dieser Patienten angenommen werden und entsprechende Hygienemaßnahmen konsequent fortgeführt werden.
- Eine generelle Indikation zu spezifischen therapeutischen Maßnahmen bei prolongierter Ausscheidung von SARS-CoV-2 lässt sich aus den aktuell verfügbaren Daten nicht ableiten.
Stand des Wissens
Typischerweise wird eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 durch Detektion viraler RNA per RT-PCR in respiratorischem Material festgestellt. Die Viruslast ist im Regelfall um und kurz vor Symptombeginn am höchsten und nimmt dann graduell ab. Ab dem 21. Tag ist das Virus meist nicht mehr nachweisbar.
Für bekannte respiratorische Viren wie Influenza oder saisonale Coronaviren ist für Krebspatienten eine Verlängerung dieser Detektierbarkeit (im Folgenden „Shedding“) gut bekannt und beschrieben. Als Risikogruppe für ein prolongiertes Shedding wurden unter anderem Patienten nach allogener Blutstammzelltransplantation identifiziert.
Mittlerweile wurde dieses prolongierte Shedding bis >100 Tage nach Diagnose auch für SARS-CoV-2 RNA wiederholt beschrieben. Dabei stellte sich heraus.dass neben Patienten mit einem schweren Erkrankungsverlauf auch immunsupprimierte Patienten - insbesonder mit einem B-Zell-Mangel - betroffen sind.
Obwohl der Nachweis von viraler RNA in aller Regel mit dem Vorliegen infektiöser Viruspartikel gleichzusetzen ist, muss dies nicht immer klinisch relevante Infektiosität bedeuten.
Diagnostisch wird standardmäßig von Infektiosität ausgegangen, wenn Viren anzüchtbar sind. Zwei Faktoren beeinflussen die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Virusanzucht wesentlich: die Dauer der Infektion und die angenommene Viruslast, reflektiert durch den cycle threshold (Ct)-Wert.
Je höher der Ct-Wert, desto geringer die Last der nachgewiesenen Viren und parallel desto geringer die Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Virusanzucht. Die Gesellschaften weisen darauf hin, dass aktuell verfügbare Daten keine Festlegung eines Grenzwertes der Ct-Werte erlauben, ab dem eine Virusanzucht ausgeschlossen ist. Da die Virusanzucht ein aufwendiges und langwieriges Verfahren ist, etabliert sich aktuell als weitere Möglichkeit, aktiv replizierende Viren nachzuweisen, der Nachweis sogenannter subgenomischer RNA.
Die Gesellschaften berichten über Fälle von Patienten mit einer B-Zell-Depletion bzw. -dysfunktion, wo eine prolongierte Infektiosität über mehrere Monate nachgewiesen werden konnte.
Mit der aufgrund der noch unvollständigen Datenlage gebotenen Vorsicht, jedoch in Zusammenschau mit dem bekannten Wissen und Erfahrungen von anderen respiratorischen Viren, fassen duie Autoren der Stellungnahme zusammen, dass eine prolongierte Ausscheidung von SARS-CoV-2 bei immunsupprimierten Patienten, vor allem bei B-Zell-Dysfunktion, wiederholt zu beobachten sein wird.
Monitoring per RT-PCR sinnvoll
Ein entsprechendes Monitoring dieser Patienten per RT-PCR scheint somit sinnvoll, so die Autoren. Insbesondere sind damit wiederholte Testungen mittels RT-PCR nach klinischer Notwendigkeit wie z.B. vor Therapien, vor stationären Aufnahmen oder bei Symptompersistenz, um nur einige zu nennen, gemeint.
Hygienemaßnahmen konsequent durchführen
Bei Nachweis von SARS-CoV-2 RNA sollte eine Infektiosität dieser Patienten angenommen werden und entsprechende Hygienemaßnahmen konsequent fortgeführt werden. Sollte im Einzelfall für das therapeutische Management dieser Patienten eine weitergehende Abklärung der Infektiosität essentiell sein, kann der Versuch einer Virusanzucht sowie eine Analyse auf subgenomische RNA weitere Hilfestellung bieten.
Eine generelle Indikation zu spezifischen therapeutischen Maßnahmen bei prolongierter Ausscheidung von SARS-CoV-2, beispielsweise die Applikation von Rekonvaleszenten-Plasma, lässt sich aus den aktuell verfügbaren Daten nicht ableiten.













