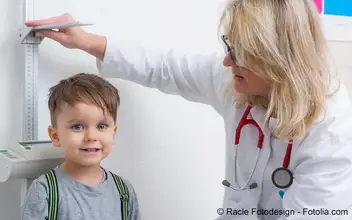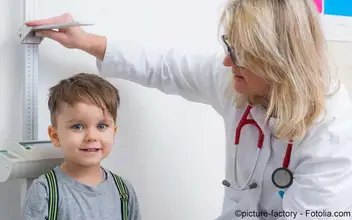Das soziale Umfeld ist unzweifelhaft einer der Faktoren, der die geistige Entwicklung eines Kindes beeinflusst. Doch diese soziale Umgebung lässt sich noch in weitere Faktoren unterteilen. Psychologen und Kinderärzte unter der Leitung der Universität Tennessee analysierten hier vor allem die sozialen Beziehungen der Mütter.
Soziale Beziehungen jenseits von Mutter und Kind
Im Einzelnen fragten die Wissenschaftler unter der Leitung von Dr. Eun Kyong Shin von der Universität Tennessee in Memphis nach den Beziehungen zwischen Mutter und Kind, zwischen Kind, Mutter und Vater, nach Familien- und Wohnverhältnissen, dem soziale Netzwerk zur Unterstützung der Mutter, und den Verbindungen zur Nachbarschaft. Dem gegenübergestellt wurde die kognitive Entwicklung der Kinder im Alter von 2 Jahren, gemessen mit den Bayley Scales of Infant Development (BSID).
Im Rahmen des Projektes CANDLE (Conditions Affecting Neurocognitive Development and Learning in Early Childhood) führten sie eine Kohortenstudie mit 1.082 Mutter-Kind-Paaren im US-Bundesstaat Tennessee durch [1]. Darunter waren zwei Drittel Afro-Amerikanerinnen.
Großer Bekanntenkreis fördert, große Familie hemmt
Eines der Hauptergebnisse war, dass die Größe des die Mutter unterstützenden sozialen Netzwerkes mit der frühkindlichen Entwicklung positiv korrelierte; der mittlere Anstieg des BSID-Koeffizienz-Scores betrug 0,4 Punkte (95%-Konfidenzintervall 0,001 bis 0,80; p = 0,05).
Des Weiteren stellte sich heraus, dass auch die Bekanntschaft mit vielen Nachbarn den BSID-Koeffizienz-Score um durchschnittlich 1,39 Punkte steigen ließ, jedoch war diese bei einem 95%-KI von -0,04 bis 2,83 nicht signifikant (p = 0,06).
Negativ wirkt sich die Größe der Familie aus. Hier zeigte sich eine negative Assoziation mit der frühkindlichen Entwicklung: Der BSID-Koeffizienz-Score verringerte sich um 2,21 (95%-KI 0,40 bis 4,02; p = 0,01).
Studienkritik: viele Unterprivilegierte in der Stichprobe
Allerdings lassen sich diese US-amerikanischen Daten nicht ohne Weiters auf Deutschland übertragen. Im Vergleich zu deutschen Durchschnittswerten hatte die hier untersuchte Kohorte einen hohen Anteil von unterprivilegierten Familien (40,9% unter der offiziellen Armutsgrenze), die Mütter waren jünger (26,55 Jahre) und 42% der Kinder wuchsen ohne Vater auf.
Dennoch sind diese Studienergebnisse im Einklang mit der plausiblen Annahme, dass sich ein funktionierendes soziales Netzwerk der Mutter und vielfältige Beziehungen jenseits der Mutter-Kind-Vater-Triade günstig auf die kognitive Entwicklung bei Kleinkindern auswirken.