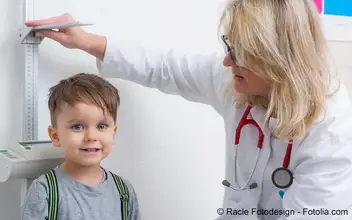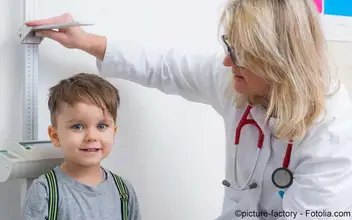Das Trockene Auge (Sicca-Syndrom; Dry eye disease) ist eine multifaktorielle Erkrankung der Augenoberfläche, bei der ein instabiler, hyperosmolarer Tränenfilm, Entzündungen der Augenoberflächen bzw. Tränendrüsen sowie Schädigungen eine Rolle spielen. Prävalenzschätzungen zufolge sind zwischen 5% und 50% der Bevölkerung betroffen, wobei der große Unterschied unter anderem auf eine uneinheitliche Definition des Krankheitsbildes zurückzuführen ist. Typische Beschwerden sind Schmerzen, Müdigkeit sowie Sehstörungen, die sich sowohl auf das alltägliche (Lesen, Autofahren) als auch auf das berufliche Leben (Arbeitsproduktivität) auswirken.
Risikofaktoren des Sicca-Syndroms
Neben intrinsischen Faktoren wie zunehmendes Alter, weibliches Geschlecht und systemische Autoimmunerkrankungen (z. B. Sjörgen-Syndrom) erhöhen auch verschiedene extrinsischen Risikofaktoren wie das Tragen von Kontaktlinsen, eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit oder auch die Nutzung digitaler Bildschirme für Arbeit, Kommunikation und Unterhaltung das Risiko, an dem Sicca-Syndrom zu erkranken. Da gerade die Bildschirmnutzung während der COVID-19-Pandemie deutlich zugenommen hat, entschlossen sich Associate Professor Zaina Al-Mohtaseb (Baylor College of Medicine, Houston) und ihr Team, eine Übersichtsarbeit anzufertigen. In dieser beschreiben sie Faktoren, die für einen Zusammenhang zwischen trockenem Auge sowie Bildschirmnutzung verantwortlich sein könnten, und erörtern verschiedene Präventions- und Behandlungsstrategien.
Zusammenhang zwischen dem Sicca-Syndrom und der Bildschirmnutzung
Laut Al-Mohtaseb und Team beweisen umfangreiche Querschnittsstudien, dass sich das Risiko, an einem Sicca-Syndrom zu erkranken bzw. für schwere Symptome, mit der Dauer der Bildschirmnutzung erhöht. Grund hierfür könnte eine Verschlechterung der Tränenfilm-Qualität sein. So weisen Personen, die unter Trockenen Augen leiden und weiterhin lange an einem digitalen Bildschirm arbeiten, einen höheren Erkrankungsschweregrad auf, der sich in einer Funktionsstörung der Meibomdrüsen (spezifische Talgdrüsen des Lidrands), in einer verkürzten Tränenaufbruchszeit sowie in einer Verfärbung der Augenoberfläche zeigt.
Einfluss der digitalen Bildschirme auf die Blinzeldynamik
Die am weitesten verbreitete Hypothese zur Erklärung dieses Zusammenhangs ist, dass digitale Bildschirme die Dynamik des Blinzelns beeinflussen, indem sie die Blinzelrate und die Vollständigkeit des Blinzelns reduzieren. Denn zwischen jedem einzelnen Blinzeln verdunsten wässrige Tränen aus dem Tränenfilm. Daher ist ein vollständiges Blinzeln erforderlich, um Tränen aus den Tränendrüsen sowie Lipide aus den Meibomdrüsen über die Augenoberfläche zu verteilen und den Tränenfilm wieder aufzufüllen. Reduziertes oder unvollständiges Blinzeln ermöglicht somit einen größeren Verdunstungsverlust und führt zu einer Trockenheit der Augenoberfläche.
Prävention des Sicca-Syndroms
Zur Vorbeugung von Trockenen Augen empfehlen Al-Mohtaseb und Team
- Blinzelübungen: Beispielsweise konnte das zweimal für zwei Sekunden lange Schließen der Augen gefolgt von einem zwei Sekunden langen fest Zusammendrücken der Augenlider Sicca-Syndrom-Beschwerden reduzieren.
- Das sogenannte „Blind Working“, bei dem die Betroffenen die Augen schließen, wenn das Sehen nicht erforderlich ist.
- Die 20-20-20-Regel, bei der die Betroffenen alle 20 Minuten eine 20-sekündige Pause einlegen und auf etwas schauen sollten, das sich in einem Abstand von 20 Fuß (etwa sechs Meter) befindet
- eine Umgebungsänderung (z. B. Tischluftbefeuchter)
- das 40-minütige Tragen eines Virtual-Reality-Headsets.
Diagnose der Trockenen Augen
Augenärzte sollten sich laut Al-Mohtaseb und Team bei der jährlichen Augenuntersuchung nach den digitalen Gewohnheiten und eventuellen Symptomen ihrer Patienten erkundigen. Bei der anschließenden Untersuchung der Risikopatienten helfen die Fragebögen „Dry Eye Questionnaire – 5 Item“ (DEQ-5), „Ocular Surface Disease Index“ (OSDI) sowie „Standard Patient Evaluation of Eye Dryness“ (SPEED). In den klinischen Tests sollten die Tränenaufrisszeit, die Färbung der Augenoberfläche, die Höhe des Tränenmeniskus sowie die Augenlider, Wimpern und Meibomdrüsensekrete untersucht werden. Zu den Labor-/Bildgebungsuntersuchungen gehören die Osmolarität des Tränenfilms, das Vorhandensein von Entzündungsmarkern, die Analyse der Lipidschicht und die Visualisierung der Meibomdrüsen.
Behandlung des Sicca-Syndroms
Behandlungsziel ist die Wiederherstellung der Homöostase des Tränenfilms, z. B. durch Behandlung der Tränenfilminsuffizienz, der Meibomdrüsen-Dysfunktion oder der Entzündungen. Bei der Therapieentscheidung können klinische Leitlinien wie Tear Film and Ocular Surface Society Dry Eye Workshop II mit abgestuften und Behandlungsempfehlungen, der präoperative Algorithmus für Augenoberflächenerkrankungen der American Society of Cataract and Refractive Surgery und die empfohlenen Behandlungsoptionen der Cornea, External Disease and Refractive Society-Gruppe helfen. Zudem können auch Lebensstiländerungen (vollständiges Blinzeln, häufige Pausen, reduzierte Bildschirmnutzung) sowie Strategien, die bei der Bewältigung des Computer-Vision-Syndroms angewandt werden (größere Schriftgröße, Reduzierung von Blendeffekten, Verbesserung des Kontrasts) sinnvoll sein.