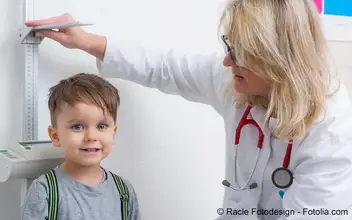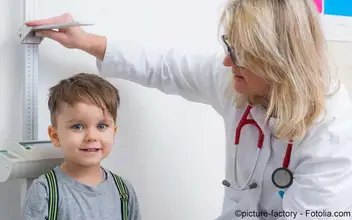In und auf dem menschlichen Körper sind in unterschiedlichsten Zusammensetzungen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze und Viren zu finden, z. B. auf der Haut und Schleimhäuten oder als Darmflora. Wann und wie diese Besiedlung stattfindet, war und ist Forschungsgegenstand, denn die Kontakte mit potenziellen Erregern sind unter anderem für die Ausbildung unseres Immunsystems verantwortlich.
Zeitpunkt der Besiedelung
Lange ging man davon aus, dass der Kontakt erst unter und kurz nach der Geburt stattfindet. Grund für diese Annahme sind anatomische und immunologische Grundsätze, die auf eine gewisse Sterilität hinweisen. Die befruchtete Eizelle (Blastozyste) nistet sich vollständig in die Uterusschleimhaut ein und von dort ausgehend ist der Fetus ab der 13. Woche von der Ammnionhöhle und den Eihäuten umgeben.
Jüngste Studien stellten diese Annahme nun immer wieder in Frage. Verschiedene Forschungsgruppen konnten unabhängig voneinander Bakterien in bspw. der Plazenta, dem Fruchtwasser oder Mekonium nachweisen, was demnach für eine Besiedlung und Kontakt vor der Geburt sprechen würde.
Sollte ein fetales Mikrobiom existieren, würde das den bisherigen immunologischen und anatomischen Erkenntnissen widersprechen, denn die Plazenta ist nach aktuellem Stand nicht durchlässig für die meisten der Bakterien und Viren, um das Ungeborene vor Infektionen zu schützen.
Analyse des aktuellen Forschungsstandes
Ein interdisziplinäres Team mit Beteiligungen der Fachrichtungen aus u.a. der Reproduktionsbiologie, Immunologie, Mikrobiomforschung und Mikrobiologie untersuchte und hinterfragte in ihrer Arbeit verschiedene Studien und Veröffentlichungen, die sich mit dem Thema des fetalen Mikrobioms beschäftigten.
Kontamination führte zu widersprüchlichen Ergebnissen
Die Forscher waren sich einig, dass die Ergebnisse und Nachweise von Bakterien auf Kontaminationen der Proben zurückzuführen seien. Sie schließen das Vorhandensein eines fetalen Mikrobioms somit aus.
Viele der nachgewiesenen Bakterien waren typische Erreger für Kontaminationen. Außerdem schlussfolgerten sie, dass im Falle eines Mikrobioms gleiche Stämme hätten vorhanden sein müssen, was nicht der Fall war.
Was bedeutet diese Erkenntnis für die Zukunft?
In zukünftigen Studien sollte der Fokus somit nicht auf dem fetalen Mikrobiom liegen, sondern sich weiter auf die Entwicklung des fetalen Immunsystems sowie die Prozesse und Mechanismen, die perinatal stattfinden, konzentrieren. Eine Hypothese, die ebenfalls weiterer Forschung bedarf, ist die Weitergabe von mikrobiellen Stoffwechselprodukten über die Plazenta.
Lösungsansätze, um Kontaminationen vorzubeugen
Das Team um K. Kennedy zeigt abschließend Möglichkeiten und Vorgehensweisen auf, um in Zukunft Kontaminationen zu minimieren bzw. frühzeitig zu identifizieren.
Für potenziell sterile Gewebe, wie Plazenta und Fetus, aber auch Gehirn- oder Tumorproben, sollte das Studiendesign die Möglichkeit der Kontamination direkt adressieren. Initial sollten quantitative Methoden, z. B. PCR (Polymerasekettenreaktion [Polymerase Chain Reaction]) mit niedriger Nachweisgrenze und eine visuelle Darstellung mittels Gram-Färbung oder Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) gewählt werden. Damit soll festgestellt werden, ob generell Mikroorganismen anwesend sind, bevor eine Sequenzierung dieser erfolgt. Bei der DNA-Sequenzierung sollten anschließend mehrere Methoden angewandt und verschiedene Kits verwendet werden. Weitere Maßnahmen zum Beweis sollten zusätzlich vorgenommen werden, wie bspw. das Kultivieren der Bakterien.
Damit würden Kontaminationen reduziert und mögliche falsch positive Ergebnisse minimiert werden.