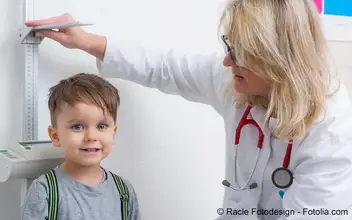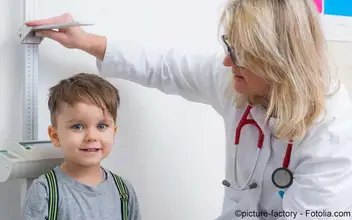Die funktionelle Obstipation ist eine weltweit verbreitete, häufige Erkrankung bei Kindern und Jugendlichen. Sie ist durch seltene, schmerzhafte und harte Stühle gekennzeichnet. Stuhlinkontinenz und Bauchschmerzen können begleitend auftreten. Die Symptome lassen sich zudem nicht durch eine andere Erkrankung erklären.
Die klinische Diagnose basiert auf einer Anamnese und körperlichen Untersuchung. Bei der Diagnose können die Rom-IV-Kriterien angewendet werden:
| Kinder bis vier Jahre | Kinder über vier Jahre |
Mind. zwei der folgenden Symptome für mind. ein Monat: 1. Zwei oder weniger Stuhlgänge pro Woche 2. Übermäßige Stuhlretention 3. Schmerzhafter oder harter Stuhlgang 4. Stuhl mit großem Durchmesser 5. Vorhandensein größerer Stuhlmassen im Rektum Bei toilettentrainierten Kindern können die folgenden, zusätzlichen Kriterien verwendet werden: 6. Mehr als eine Inkontinenzepisode/Woche 7. Stühle mit großem Durchmesser, die die Toilette verstopfen können | Mind. einen Monat lang einmal die Woche mind. zwei der folgenden Symptome 1. Zwei oder weniger Stuhlgänge pro Woche 2. Eine oder mehr Episoden von Stuhlinkontinenz pro Woche 3. Stuhlretention 4. Schmerzhafter oder harter Stuhlgang 5. Vorhandensein größerer Stuhlmassen im Rektum 6. Stühle mit großem Durchmesser, die die Toilette verstopfen können |
Gemäß den internationalen Leitlinien beginnt die Behandlung bei Kindern mit funktioneller Obstipation mit Entmystifizierung, Aufklärung, Toilettentraining und einer abführenden Therapie mit Polyethylenglykol (PEG). Auch eine normale Ballaststoff- und Flüssigkeitsaufnahme sowie regelmäßige körperliche Aktivität werden empfohlen. Es gibt keine Empfehlung für Probiotika, Präbiotika oder Verhaltenstherapie aufgrund fehlender Wirksamkeitsbelege.
Abführmittel sind unbeliebt
Laxanzien sind sicher, die Adhärenz ist allerdings oft gering. Mit der Ausnahme von PEG ist zudem wenig über die Langzeitwirkungen bei chronischer Anwendung bekannt. Das kann erklären, warum 36,4% der Eltern von Kindern mit funktioneller Verstopfung Methoden aus der komplementären oder alternativen Medizin bevorzugen.
Zielsetzung
Die Autoren des vorliegenden Reviews bewerteten die Wirksamkeit und Sicherheit nichtpharmakologischer Interventionen verglichen mit anderen Therapien oder keiner Behandlung bei funktioneller Obstipation im Kindesalter.
Methodik
Das Autoren-Team der niederländischen Universität Wageningen untersuchte randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) zur Bewertung nichtpharmakologischer Behandlungen bei Kindern mit funktioneller Obstipation. Die Wissenschaftler durchsuchten die Datenbanken Cochrane Library, PubMed und EMBASE von Beginn bis August 2020. Um weitere Studien zu identifizieren, wurden Referenzlisten eingeschlossener Studien und (systematische) Übersichtsartikel manuell überprüft. Fremdsprachige Artikel wurden übersetzt.
Einschusskriterien
Die eingeschlossenen Studien mussten folgende Kriterien erfüllen:
- Es handelte sich um (systematische Überprüfungen von) RCT(s), in denen eine nichtpharmakologische Behandlung mit einer anderen Behandlung, Placebo oder keiner Behandlung verglichen wurde
- Die Studienpopulation bestand aus Kindern im Alter von null bis 18 Jahre mit funktioneller Obstipation
- Die Diagnose der funktionellen Obstipation wurde klar definiert oder es wurden international anerkannte Kriterien wie die Kriterien von Rom III oder Rom IV verwendet
- Die Studie verwendete mindestens ein Ergebnis des Core Outcome Sets (COS) für klinische Studien bei Verstopfung, nämlich Stuhlgangshäufigkeit, Stuhlkonsistenz, schmerzhafter Stuhlgang, Lebensqualität von Eltern und Patienten, Nebenwirkungen der Behandlung, Stuhlinkontinenz, Bauchschmerzen und Schulbesuch
Ergebnisbewertung
Die primären Endpunkte für die systematische Überprüfung und Metaanalyse waren Behandlungserfolg und Defäkationshäufigkeit. Sekundäre Endpunkte umfassten alle anderen Endpunkte des COS. Das Biasrisiko jeder eingeschlossenen Studie wurde unabhängig von zwei Autoren nach dem Cochrane Risk of Bias Tool Version 2.20 bestimmt.
Ergebnisse
Die Autoren schlossen 52 RCTs mit 4.668 Kindern im Alter zwischen zwei Wochen und 18 Jahren ein, von denen 47% weiblich waren.
37 Studien (71%) verwendeten die Rom-Kriterien für funktionelle Obstipation und 15 (29%) verwendeten von den Autoren definierte Kriterien. Zusätzlich zu den untersuchten Interventionen wurde in 28 (57%) Studien zum Toilettentraining beraten und in 19 (39%) zur Ernährung.
Die Interventionen in den Studien umfassten Probiotika (n=15), Präbiotika/Ballaststoffe/Säuglingsanfangsnahrung (n=11), Synbiotika (n=2), Kuhmilchausschlussdiät (n=2), (zusätzliche) Wasseraufnahme (n=1), orale Nahrungsergänzungsmittel (Cassia-Fistel-Emulsion, Samen von Descurainia sophia, Xia‘er Biantong Granulat, Biomasse aus grünen Bananen oder schwarze Melasse) (n=6), Biofeedback (n=4), Elektrotherapie (1 mit Kryotherapie) (n=4), Massagetherapie (n=3), Beckenphysiotherapie (n=1), Verhaltenstherapie (n=1), trockenes Schröpfen (n=1) und eine Kombination aus Bauchmuskeltraining, Atemübungen und Bauchmassage (n=1).
Wirksame Behandlungen
Es zeigte sich, dass eine Kuhmilchausschlussdiät (n=2 in einer Subpopulation mit Verstopfung als möglicher Manifestation einer Kuhmilchallergie), abdominale Elektrostimulation (n=3) und Cassia fistula-Emulsion (n=2) wirksam sein können. Hinweisen aus RCTs zufolge, die nicht in die Metaanalysen einbezogen wurden, könnten einige Präbiotika und Fasermischungen, Xiao‘er Biantong Granulat und Bauchmassage erfolgsversprechend Therapien sein.
Aus den Studien ließ sich kein Nutzen von Probiotika, Synbiotika, einer erhöhten Wasseraufnahme, trockenes Schröpfen, Biofeedback oder Verhaltenstherapie ableiten. Die Autoren fanden keine RCTs zu körperlicher Bewegung oder Akupunktur.
Wenig Nebenwirkungen
Die eingeschlossenen Studien waren heterogen bezüglich Studiendesign, diagnostische Kriterien für funktionelle Obstipation, Studienpopulation, Studienintervention, Dauer der Behandlung und Nachsorge und Zielparameter. Unerwünschte Ereignisse wurden in der Mehrheit der Studien berichtet (33 von 52). Sie waren mild und bestanden hauptsächlich aus vorübergehenden Störungen wie Bauchschmerzen, Durchfall oder anderen gastrointestinalen Symptomen. Es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet.
Diskussion der Ergebnisse
In den meisten Studien wurde ein hohes Bias-Risiko festgestellt. Die Ergebnisse des vorliegenden systematischen Reviews sollten daher gemäß den Autoren mit Vorsicht interpretiert werden.
Präbiotoka und Ballaststoffe
Die Metaanalyse ergab, dass einige Präbiotika und Ballaststoffmischungen wirksame Behandlungen darstellen können, Probiotika und Synbiotika indes nicht. Die unterschiedlichen Effekte beruhen vermutlich darauf, dass Präbiotika und Ballaststoffe Wasser binden und dadurch die Fäkalienbildung stimulieren. Zahlreiche Studien mit gesunden Säuglingen, die eine mit Präbiotika und/oder Ballaststoffen ergänzte Säuglingsanfangsnahrung bekommen haben, bestätigen eine stuhlerweichende Wirkung. Auch der gegenteilige Effekt, dass eine geringe Ballaststoffaufnahme mit Verstopfung assoziiert ist, ist für das Kindesalter belegt.
Wie bei Abführmitteln ist ein Dosis-Wirkungs-Effekt bei Ballaststoffen und Präbiotika anzunehmen. In einigen der eingeschlossenen Studien wurde eine niedrige Dosis an Ballaststoffen und Präbiotika verwendet, was die beobachtete Ineffektivität erklären könnte. Einige Mittel könnten auch keinen Einfluss auf eine funktionelle Obstipation haben.
Geeignete Dosierungsschemata für Ballaststoffe und Präbiotika sind bislang nicht etabliert. Die Autoren empfahlen Studien, um zu prüfen, welche Ballaststoffe und präbiotischen Mischungen genau und in welchen Dosierungen zu verwenden sind.
Mikrobiota beachten
Von den in den systematischen Review eingeschlossen Studien bewerteten nur drei die Auswirkungen der Intervention auf die Zusammensetzung der Mikrobiota. Die Autoren raten, dass in zukünftigen Studien auch untersucht wird, wie sich die Darmmikrobiota unter der Intervention verändert. Das könne dazu beitragen, die Wechselwirkungen zwischen Wirt und Mikroben besser zu verstehen und mögliche Unterschiede zwischen Respondern und Non-Respondern zu identifizieren. Das Ziel sei eine personalisierte Darmmikrobiom-gerichtete Medizin oder nichtpharmakologische Behandlung.
Die Autoren stellten einen Mangel an Evidenz für bestimmte diätetische Interventionen oder Nahrungsergänzungen fest. Zukünftige Studien könnten darauf fokussieren, die Wirkungen von Cassia fistula-Emulsion, Xiao‘er Biantong-Granulat oder schwarzer Melasse als alternative Abführmittel zu untersuchen. Gemäß aktuellen Leitlinien für Erwachsene mit funktioneller Verstopfung ist die chinesische Kräutermedizin mit Mitteln wie Xiao‘er Biantong-Granulat wirksam. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die optimale Formulierung und Dosierung noch unbekannt seien.
Therapien mit begrenzter Evidenz
Samen von Descurainia sophia und grüne Bananenbiomasse scheinen weniger geeignete Optionen zu sein. Etwa ein Drittel der Kinder mochte den Geschmack der Samen nicht, die Biomasse von grünen Bananen allein schien nicht wirksam zu sein. Zwei Studien mit hohem Biasrisiko deuteten darauf hin, dass eine kuhmilchfreie Ernährung bei Kindern nützlich sein könnte, bei denen die Verstopfung auf eine Kuhmilchallergie zurückgeht. Allerdings ließen sich diese Studienergebnisse laut den Autoren nicht verallgemeinern.
Eine weitere Untergruppe der identifizierten Interventionen – nämlich Biofeedback und Beckenphysiotherapie – zielten auf die Stuhlentleerung ab. Die Mehrheit der Kinder war nach dem Biofeedback-Training in der Lage, den Beckenboden zu entspannen, eine positive Auswirkung auf die Verstopfung ließ sich indes nicht feststellen.
Massagetherapie, abdominale Elektrostimulation und Kryotherapie könnten die Dickdarmmotilität direkt verbessern. Obwohl die Evidenz begrenzt und die Wirkungsweise noch unvollständig verstanden ist, können diese Interventionen einen positiven Effekt auf die funktionelle Obstipation bei Kindern haben. Bevor diese Interventionen empfohlen werden, seien laut den Autoren weitere Untersuchungen ratsam.
Fazit
Als hauptsächliche Limitationen ihres Reviews gaben die Autoren die Qualität der eingeschlossenen Studien an. Wie groß der therapeutische Effekt tatsächlich sei, sei aufgrund möglicher Publikationsbias ungewiss. Die Mehrheit der Studien (71%) wurde in einem Umfeld der Tertiärversorgung durchgeführt, was die Verallgemeinerbarkeit dieser Ergebnisse einschränke.
Die Autoren empfahlen hochwertige multizentrische Studien, die die in der COS beschriebenen Ergebnisse verwenden. In den Studien sollten die in diesem Review als am vielversprechendsten befundene Interventionen untersucht werden: spezifische Präbiotika- und Ballaststoffmischungen, abdominale elektrische Stimulation, Cassia Fistula-Emulsion und Xiao‘er Biantong-Granulat.
Zukünftige Studien könnten auch Interventionen untersuchen, zu denen keine Studien gefunden wurden, wie personalisierte Darmmikrobiota-Interventionen, Chicorée-Inulin, körperliches Training, (Elektro-)Akupunktur, andere nichtinvasive neuromodulierende Therapien wie die Stimulation des N. tibialis posterior und virtuelle und digitale Interventionen. Da Aufklärung und kontinuierliches Toilettentraining als Schlüsselelemente bei der Behandlung von Verstopfung im Kindesalter gelten, seien entsprechende Interventionen sinnvoll. Auch an die Kosten und die Kostenwirksamkeit von Behandlungen sollte verstärkt gedacht werden.
Bevor die aktuellen Behandlungsleitlinien bezüglich nichtpharmakologischer Interventionen für Kinder mit funktioneller Obstipation geändert würden, sei laut den Autoren eine bessere Evidenzlage erforderlich.