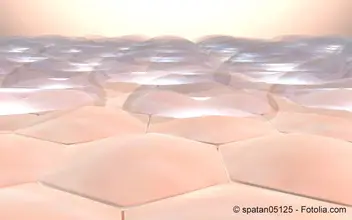Hintergrund
Im Jahre 2008 wurde in Deutschland ein opportunistisches Programm zum Hautkrebs-Screening eingeführt, das von speziell ausgebildeten Hausärzten und Dermatologen durchgeführt wird. Ab 35 Jahren können Erwachsene jedes zweite Jahr bei hausärztlich tätigen Fachärzten für Allgemeinmedizin, Fachärzten für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Dermatologen, Internisten und praktischen Ärzte, die an einer entsprechenden Fortbildung teilgenommen haben, das Hautkrebsscreening durchführen lassen.
Je früher ein Melanom erkannt wird, desto besser für den Patienten, da das Tumorstadium bei der Erstdiagnose ein wichtiger Anhaltspunkt für die Prognose ist. Das Programm des Hautkrebsscreening wird noch immer kontrovers diskutiert, da eindeutige Belege für die Wirksamkeit noch nicht gezeigt wurden.
Zielsetzung
Die retrospektive Kohortenstudie setzte sich zum Ziel einerseits die bisherigen Ergebnisse der Inanspruchnahme des Screenings auf der Grundlage einer Kohorte von Krankenkassendaten zu aktualisieren und andererseits mögliche Unterschiede in der Sterblichkeit von Melanom-Patienten in Bezug auf die Teilnahme oder Nichtteilnahme am Screening-Programm zu analysieren.
Methodik
Die Kohortenstudie basiert auf pseudonymisierten Krankenkassendaten von 1.431.327 Personen aus dem Bundesland Sachsen aus den Jahren 2010 bis 2016. Die Zahl der prävalenten und inzidenten Melanome wurde anhand von Diagnosen, medizinischen Verfahren und Verordnungen ermittelt. Zu der Interventionsgruppe zählen Patienten, die sich einem Screening unterzogen hatten und innerhalb der nächsten zwei Jahre die Erstdiagnose eines Melanoms erhielten. In der Vergleichsgruppe hingegen waren alle Melanom-Patienten, die nicht am Hautkrebs-Screening teilgenommen hatten. Unterschiede in der Sterblichkeit wurden mit Hilfe der relativen Überlebensrate und einer Cox-Regression bewertet.
Ergebnisse
Im Zeitraum von 2010 bis 2016 hatten 688.708 Personen mindestens einmal an einem Hautkrebs-Screening teilgenommen (48% der Kohorte). Unabhängig vom Screening konnten 4.552 Personen mit einem prävalenten Melanom und 2.475 Personen mit einem inzidenten Melanom in der Gesamtkohorte identifiziert werden. Von den inzidenten Fällen hatten 1.801 Melanom-Patienten (73%) ein Hautkrebs-Screening innerhalb von zwei Jahren vor ihrer ersten Melanom-Diagnose, während bei 674 Patienten (27%) die Diagnose ohne Teilnahme am Screening gestellt wurde. Bei 704 Patienten der Screening-Teilnehmer wurde die Diagnose innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Screening gestellt. Vergleicht man die Interventions- mit der Vergleichsgruppe zeigte sich, dass die Interventionsgruppe weniger lokoregionäre Metastasen (4,2% vs. 13,5%) und weniger Fernmetastasen (4,3% vs. 8,0%) in den ersten 100 Tage nach der Diagnose hatten als die Vergleichsgruppe. Ebenfalls unterzogen sich weniger Melanom-Patienten der Interventionsgruppe einer systemischen Krebstherapie (11,6% vs. 21,8%) innerhalb von 30 Tagen nach der Diagnosestellung. Die Screening-Teilnehmer hatten sowohl im nicht bereinigten Cox-Modell ein signifikant besseres Überleben (Hazard Ratio (HR): 0,37; 95%-Konfidenzintervall (KI): 0,30-0,46) als auch nach Bereinigung aller Störfaktoren (HR: 0,62; 95%-KI: 0,48-0,80).
Die Überlebensrate der Interventionsgruppe war mit der Überlebensrate der deutschen Allgemeinbevölkerung vergleichbar. Ihr Überlebensverhältnis betrug 0,90 (95%-KI: 0,87-0,93) nach einem Jahr und 0,82 (95%-KI: 0,77-0,88) nach drei Jahren.
Fazit
Die in dieser Studie vorgestellten Ergebnisse deuten darauf hin, dass das deutsche Hautkrebsscreening-Programm sich positiv auf die Prognose von Melanom-Patienten auswirkt. Gescreente Patienten hatten zum Zeitpunkt der Diagnose ein geringeres Tumorstadium und insgesamt eine verbesserte Überlebensrate und eine verminderte Mortalität.
Die langfristigen Auswirkungen des Hautkrebsscreening-Programms können aufgrund des relativ kurzen Beobachtungszeitraums nicht ausreichend analysiert werden. Unterschiede in den Überlebenszeiten innerhalb der ersten Jahre nach der Diagnose könnten durch eine Mischung aus Selektionsverzerrung, Überdiagnose oder Vorlaufzeitverzerrung im Zusammenhang mit dem Screening und nicht durch das Screening selbst verursacht worden sein.