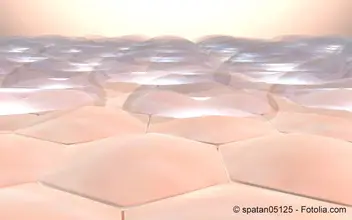Keine Frage: Kompressionstherapie ist eine der zentralen Maßnahmen in der Phlebologie, sei es zur Thromboseprophylaxe oder zur Therapie venöser Insuffizienz oder Lymphödem. Doch in der Praxis sieht es oft bitter aus: Weniger als 50% der Patienten mit venösem Ulcus cruris erhalten eine Kompressionstherapie, berichtete PD Dr. Cornelia Erfurt-Berge von der Universität Erlangen.
Fehler bei der Anwendung
Auch wenn eine Kompressionstherapie verordnet wird, sind sich viele Ärzte nicht bewusst, vor welche Probleme sie damit die Patienten stellen.
Verbände mit Kurzzugbinden werden meist nur kurzfristig eingesetzt, zumal es für die meisten Patienten schwierig ist, diese selbst anzulegen. Weil auch das Personal, vor allem in der häuslichen Pflege, nicht immer für das „Wickeln der Beine“ ausreichend geschult ist, passieren häufig Fehler – was sich beispielsweise durch Schnürfurchen zeigt. Erfurt-Berge zitierte eine Studie aus dem eigenen Haus, nach der zwar 77% der Patienten, die in die phlebologische Ambulanz kommen, bereits eine Kompressionstherapie erhalten, aber davon bei mehr als 40% diese schlecht ausgeführt war (1).
Kraftakt Kompressionsstrumpf anziehen
Auch bei der Verordnung von maßangefertigten Kompressionsstrümpfen sieht es nicht besser aus. Hier erfolgt in der Regel nur eine kurze Einweisung durch das Sanitätshaus. Wer selbst einmal Kompressionsstrümpfe der Klasse III angezogen hat, weiß welche Ansprüche dies an Beweglichkeit und Kraft stellt. Eine Herausforderung, denen Ältere oft nicht gewachsen sind.
Selbst bei den weniger starken Antithrombosestrümpfen wie sie bei mobilitätseingeschränkten Patienten zur Thromboseprophylaxe eingesetzt werden, kommen die Patienten allein nicht immer zurecht.
Eingewachsener Strumpf
Wie fatal sich die falsche Anwendung gerade bei älteren alleinstehenden Frauen auswirken kann, schildert eine Fallbeschreibung des Elblandklinikums in Riesa (2).
Eine 69-jährige Patientin wurde in die chirurgische Notfallambulanz eingeliefert: Sie hatte ihren Kompressionsstrumpf nicht ausziehen können. Er war lediglich heruntergerollt worden und so drei Wochen lang an Ort und Stelle verblieben. Bei der Aufnahme war der Rand des Strumpfes in die Weichteile des linken Unterschenkels eingewachsen, dem fauliger Geruch entströmte. Nach Entfernen des Strumpfes bis zum eingerollten Gummirand zeigten sich vor allem interdigital sowie an Fußrücken und Fußsohle borkig-krustige Hautbeläge mit oberflächlich blutenden Mazerationen. Der gesamte Unterschenkel war unterhalb des Knies gerötet und geschwollen. Die Weichteileinschnürungen waren auch im Röntgenbild sichtbar.
Operative Entfernung
Der restliche Strumpf, das heißt der Gummirand, wurde chirurgisch entfernt. Es zeigte sich eine zirkuläre Nekrose mit freiliegender Sehne des M. tibialis anterior und der Achillessehne. Die Defektgröße betrug. 5,5 cm × 25 cm.
Nach Abheilung wurde der Defekt mit einem M.-peronaeus- brevis-Lappen gedeckt.
Therapie kontrollieren
Zugegeben, dies ist eine Maximalvariante einer Komplikation durch eine Kompressionstherapie. Dennoch unterstreiche diese Krankheitsgeschichte, wie wichtig eine adäquaten Patientenschulung vor Beginn einer Kompressionstherapie sei, so die Chirurgen aus Riesa. Vor allem sollte dabei den korrekten Sitz und das regelmäßige Ausziehen des Kompressionsstrumpfes geachtet werden (2).
Schulung hilft
Dass Schulungen der Patienten bzw. der Pflegepersonen die Qualität der Kompressionstherapie verbessern, lässt sich belegen: nach einer einmaligen Schulung verbesserte sich die Qualität des Kompressionsverbandes um etwa 40%, wie Erfurt-Berge berichtete (1).
An Grunderkrankungen denken,
Bei der Verordnung sollte auch an die Grunderkrankungen gedacht werden. Bei der Beispielpatientin war ein Diabetes mellitus und eine Zwangsstörung bekannt. Besonders bei Patienten mit psychischen Begleiterkrankungen sollte eine Kompressionstherapie mit Bedacht angewendet und engmaschig kontrolliert werden.
Moderne Kompressionssysteme
Hilfreich könnte auch die Verordnung von modernen Kompressionssystemen − z.B. mit einstellbarem Klettverschluss − sein, die das Anlegen erleichtern und somit die Adhärenz an diese aufwändige und meist unbequeme Therapiemaßnahme steigern (1).