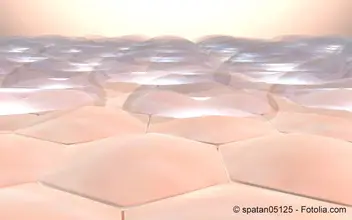Hintergrund
Das maligne Melanom ist die aggressivste Form von Hautkrebs und mit stark steigender Inzidenz eine der häufigsten Tumorerkrankungen in Deutschland. Das maligne Melanom stellt bei Frauen die vierthäufigste und bei Männern die fünfthäufigste Krebserkrankung dar. Seit den 1970er Jahren hat sich die Zahl der Fälle mehr als verfünffacht. Wird die Erkrankung im Frühstadium entdeckt, sind die Heilungschancen sehr hoch, da der Tumor operativ entfernt werden kann. Sind die Tumorherde jedoch in gesundes Gewebe eingewachsen und haben durch Absiedelung über Blut- und Lymphbahnen Metastasen gebildet, verschlechtert sich die Prognose.
Für die Auswahl der optimalen Therapie ist es von größter Wichtigkeit, das Ausmaß der Erkrankung zu kennen, also alle Tumorherde sicher zu identifizieren. Hierfür eignet sich insbesondere die Ganzkörper-Bildgebung, speziell die Positronen-Emissions-Tomographie (PET), durch die entartetes Gewebe sicher von gesundem Gewebe unterschieden werden kann. Dabei kommen radioaktiv markierte Substanzen zum Einsatz, die zielgerichtet an für die Tumorzellen spezifische Oberflächenprotein binden.
Beim malignen Melanom wird üblicherweise der Melanocortin-1-Rezeptor (MC1R) als Zielstruktur für den Nachweis von Tumorzellen genutzt. Der MC1R ist in der Mehrzahl der primären malignen Melanome stabil überexprimiert. Bei der Metastasierung kann dieses Oberflächenprotein jedoch verloren gehen, sodass dort MC1R-zielgerichtete radiomarkierte Substanzen nicht mehr binden, und die entsprechenden Tumorherde nicht dargestellt werden können.
Bei der Metastasierung in Lymphknoten und fortschreitendem Tumorwachstum des malignen Melanoms spielt das sogenannte Integrin αvβ3, ebenfalls ein Oberflächenprotein, eine wichtige Rolle.
Zielsetzung
Wissenschaftler der Abteilung für Molekulare Bildgebung und Radiochemie an der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), unter der Leitung von Prof. Dr. Björn Wängler, nahmen an, dass die Kombination von zwei Peptiden, die die zwei verschiedenen Rezeptoren ansprechen, zu einem heterobivalenten peptidischen Liganden (HBPL) im Vergleich zu monovalenten Peptidliganden eine verbesserte Tumor-Targeting-Sensitivität und damit Tumorvisualisierung ermöglicht.
Auf dieser Basis entwickelten sie eine neue Klasse an Bildgebungsagenzien, radiomarkierte Moleküle, die an zwei unterschiedliche Oberflächeneiweiße binden. Die Projektergebnisse wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Pharmaceuticals veröffentlicht [1, 2].
Methodik
Die Entwicklung dieser komplett neuen Substanzklasse umfasste das molekulare Design und die Etablierung eines geeigneten Reaktionsweges. Um systematisch Einflüsse verschiedener Strukturelemente auf die biologischen Eigenschaften der Substanzen ermitteln zu können, wurde der molekulare Aufbau variiert.
Anschließend erfolgte die Radiomarkierung der Verbindungen mit dem Positronen-Emitter 18F, um sie mittels PET nachweisbar zu machen. Hierbei kam eine in der Arbeitsgruppe entwickelte, sogenannte SiFA (Siliziumfluorid-Akzeptor)-Technologie zum Einsatz, die sich besonders für die klinische Translation eignet.
Um das Potenzial der Substanzen für die Tumorbildgebung im Patienten zu ermitteln, wurden sie zunächst an Tumorzellen getestet. Die vielversprechendsten radiomarkierten Substanzen prüften die Wissenschaftler anschließend auch im Tiermodell des malignen Melanoms.
Ergebnisse
Die Forscher entwickelten verschiedene SiFAlin-modifizierte HBPL, bestehend aus einem MC1R- (GG-Nle-c(DHfRWK)) und einem Integrin αvβ3-affinen Peptid (c(RGDfK)), die durch ein symmetrisch verzweigtes Gerüst mit Linkern unterschiedlicher Länge und Zusammensetzung verbunden waren. Die HPBL wurden mit 18F radioaktiv markiert. Die radiochemischen Ausbeuten von sechs Produkten lagen bei 27-50%, die radiochemischen Reinheiten bei ≥ 95% und die nicht optimierten molaren Aktivitäten bei 17-51 GBq/μmol.
Die Radiotracer wurden hinsichtlich logD(7.4) und Stabilität im humanen Serum bewertet. Außerdem wurden die Rezeptoraffinitäten der HBPL in vitro an Zelllinien untersucht, die Integrin αvβ3 (U87MG-Zellen) oder MC1R (B16F10) überexprimierten.
Basierend auf diesen Ergebnissen wurden die vielversprechendsten 18F-Verbindungen, [18F]2 mit der höchsten Affinität zu beiden Zielrezeptoren (IC50 (B16F10) = 0,99 ± 0,11 nM, IC50 (U87MG) = 1.300 ± 288 nM) und [18F]4 mit der höchsten Hydrophilie (logD(7,4) = −1,39 ± 0,03), in vivo und ex vivo in einem Xenograft-Mausmodell mit beiden Tumoren weiter untersucht. Für beide HBPL war eine klare Visualisierung von B16F10- sowie U87MG-Tumoren möglich.
Blockierungsstudien mit den jeweiligen monospezifischen Peptiden zeigten, dass beide peptidbindenden Komponenten der HBPL zur Tumoraufnahme beitrugen. Trotz der etwas niedrigeren Affinitäten zu den Zielrezeptoren (IC50 (B16F10) = 6,00 ± 0,47 nM und IC50 (U87MG) = 2.034 ± 323 nM) zeigte [18F]4 eine höhere absolute Tumoraufnahme als [18F]2 ([18F]4: 2,58 ± 0,86% ID/g bei B16F10-Tumoren und 3,92 ± 1,31% ID/g bei U87MG-Tumoren; [18F]2: 2,32 ± 0,49% ID/g bei B16F10-Tumoren und 2,33 ± 0,46% ID/g bei U87MG-Tumoren) sowie höhere Tumor-zu-Hintergrund-Verhältnisse als [18F]2.
Fazit
Es konnte bestätigt werden, dass sich heterobivalente Integrin αvβ3- und MC1R-bispezifische Radioliganden für die sensitive und spezifische Bildgebung maligner Melanome mittels PET/CT eignen. Durch die starke Bindung der neuen radioaktiven Substanzen an beide relevanten Zieleiweiße konnten erstmals alle Phasen der Erkrankung und sämtliche Tumorherde mit hoher Empfindlichkeit in der PET dargestellt werden.
„Die neu entwickelten Verbindungen sind tatsächlich in der Lage, über beide Oberflächeneiweiße an Tumorzellen zu binden. Somit ist das Konzept der zweifach zielgerichteten Anreicherung in malignen Melanomen vollständig tragfähig“, so Björn Wängler. Der Forschungsgruppenleiter sieht daher ein großes Potenzial, maligne Melanome mittels der neuartigen Substanzen künftig auch im Patienten in der klinischen Bildgebung darstellen zu können.
Das Projekt wurde von der Wilhelm Sander-Stiftung gefördert.