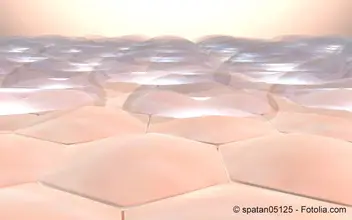Hintergrund
Die atopische Dermatitis ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, die bis zu 20% der Kinder betrifft. Die Erkrankung ist unter anderem durch Hauttrockenheit und Hautjucken gekennzeichnet. Häufig geht die Neurodermitis mit allergischen Komorbiditäten wie Asthma und allergische Rhinitis einher.
Studien konnten zeigen, dass Patienten mit atopischer Dermatitis häufig zwei SNPs (Einzelnukleotidpolymorphismen [single nucleotide polymorphisms]) im KIF3A Gen aufweisen. Als SNP bezeichnet man eine häufig auftretende genetische Variation eines Basenpaares an einer bestimmten Stelle des Genoms. Bei der atopischen Dermatitis sind bereits die SNPs „rs11740584“ und „rs2299007“ bekannt, aber bisher war unklar, auf welche Weise sie das Risiko für diese Erkrankung erhöhen. Diese beiden SNPs befinden sich in dem Gen KIF3A.
Die vorliegende Studie kombinierte daher eine Mausstudie mit einer humanen Studie, um die Auswirkungen der zwei häufigen SNPs (rs11740584 und rs2299007) im KIFA3A Gen bei der Neurodermitis zu untersuchen.
Methoden
Die Studie schloss 56 Teilnehmer, darunter 45 Kinder zwischen 7 und 17 Jahren sowie 11 Erwachsene zwischen 18 und 26 Jahren ein. Die Probanden stammten aus den Kohorten » “Greater Cincinnati Pediatric Clinic Repository (GCPCR) «”, » “Genomic Control Cohort (GCC) «”, » “Cincinnati Childhood Allergy and Air Pollution Study (CCAAPS)” « oder der » “Cincinnati Center for Eosinophilic Disorders (CCED) «”. Basierend auf den genotypischen Informationen, die aus diesen Kohorten bekannt waren, konnten die Studienteilnehmer entsprechend ihrem Genotyp für die KIF3A SNPs rs11740584 und/oder rs2299007 rekrutiert werden.
Die Arbeitsgruppe untersuchte die DNA- Methylierung und die Expression des KIF3A- Gens in Hautzellen, die mit Hilfe von Klebestreifen von der Epidermis entfernt wurden. Um herauszufinden, ob reduzierte KIF3A- Level eine atopische Dermatitis verursachen können, wurde bei Mäusen, die das Gen KIF3A vermindert exprimierten, die Auswirkung auf den transepidermalen Wasserverlust (TEWL) untersucht.
Ergebnisse
Die Forscher zeigten, dass die SNPs rs17740584 und rs2299007 eine vermehrte DNA- Methylierung des Gens KIF3A bewirkten und in Folge dessen eine verminderte Expression des entsprechenden Genproduktes bedingten.
Zudem sahen sie bei den Mäusen, die vermindert KIF3A exprimierten, einen vermehrten TEWL und damit eine zunehmende Hauttrockenheit.
Nachdem die Tiere mit Schimmelpilzen exponiert wurden, kam es zur allergischen Reaktion. Dadurch wurde die Pathogenese der atopischen Dermatitis bestätigt, bei der eine vermehrte TEWL eine Störung der Hautbarriere zur Folge hat und damit eine allergische Reaktion begünstigt.
Die Arbeitsgruppe zeigte, dass die Steigerung der TEWL auf Störungen der „Tight junctions“ und anderer Zell-Zell- Verbindungen zurückzuführen ist. Durch diese sind die Keratinozyten der Haut fest miteinander verbunden. Beim Verlust dieser Verbindungen kann Wasser zwischen den Zellen nach „außen“ gelangen und verdunsten und das TEWL steigt.
Fazit
Die Forscher konnten in der Studie zeigen, dass zwei häufige SNPs des Gens KIF3A zu einer dysfunktionalen Hautbarriere mit vermehrter TEWL führen und damit die Entwicklung einer atopischen Dermatitis begünstigen könnten. Hierdurch können schädliche Umwelteinflüsse wie beispielsweise Allergene leichter die Hautbarriere überwinden und zur Entwicklung von Lebensmittelallergien oder Asthma führen.
Die Forscher hoffen, dass die Ergebnisse der Studie dazu beitragen, dass in Zukunft neue Screening Tests oder potentielle Therapiemöglichkeiten für die atopische Dermatitis entwickelt werden könnten. Ein möglicher Screening- Test könnte laut Prof Dr. Gurjit Khurana Hershey, der Direktorin der Abteilung für Asthmaforschung der Kinderklinik
»„Cincinnati Children’s Hospital Medical Center«“ und Letztautorin der Studie, eine Zellentnahme mittels schmerzfreien Klebestreifens sein, um die KIF3A- Expression bei Säuglingen zu bestimmen. Diese könnte als möglicher Prädiktor für das Risiko der Entwicklung einer atopischen Dermatitis dienen. Die Arbeitsgruppe hat bereits eine Studie mit 600 Kindern begonnen, um dieser Fragestellung nachzugehen.