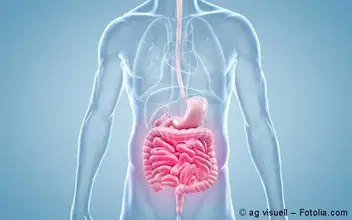Die im März 2020 zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie ergriffenen Infektionsschutzmaßnahmen in Deutschland haben zu einem starken Rückgang von darmpathogenen Erregern geführt. Dieser Trend wird durch die erfassten Fallzahlen im Meldesystem gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) im aktuellen Epidemiologischen Bulletin des Robert Koch-Instituts (RKI) abgebildet.
Bis zur 32. Kalenderwoche (KW) 2020 lag die Anzahl der gemeldeten Salmonellosen 45,4% unter dem durchschnittlichen Wert des gleichen Zeitraums der Jahre 2015–2019. Die Anzahl der Campylobacter-Enteritiden ging um 22,2% zurück, Infektionen mit enterohämorrhagischen Escherichia (E.) coli (EHEC) um 46,4%, Shigellose um 82,9%, Listeriose um 21,8% und Yersiniose um 7%.
Rückgang an eingesandten Proben
Mit Beginn der Schutzmaßnahmen ab der 11. KW 2020 bis zu den ersten umfangreicheren Lockerungen der Restriktionen in der 19. KW und nochmals mit Beginn der zweiten Infektionswelle in der 40. KW 2020 verzeichneten auch das Nationale Referenzzentrum für Salmonellen und andere bakterielle Enteritiserreger (NRZ Salm) und das Konsiliarlabor für Listerien (KL Listeria) einen in diesem Umfang nicht erwarteten Rückgang an eingesandten Proben, heißt es vom RKI.
Zu Beginn des Jahres 2020 lagen die Probeneingangszahlen am NRZ Salm im Mittel der Vorjahre 2015–2019. Bis zur 12. KW wurden ausbruchsbedingt sogar mehr Salmonellen-Isolate für die Typisierung bearbeitet. Ab März war dann für alle Erreger ein mehr oder weniger starker Rückgang an Einsendungen zu verzeichnen. Bis auf geringfügige Veränderungen lag das Einsendeniveau auch Anfang 2021 noch nicht auf dem der Vorjahre.
Lockdown dämmte Verbreitung bakterieller Enteritiserreger ein
Mit dem Lockdown wurde nicht nur die Verbreitung viraler Erreger und damit ein abrupter Rückgang von Atemwegserkrankungen erreicht, sondern auch die Verbreitung bakterieller Enteritiserreger eingedämmt. Als mögliche Gründe nennt das RKI:
- die eingeschränkte Verarbeitung und Ausgabe von Lebensmitteln
- die Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen
- die Schließung von Gastronomiebetrieben
- die geringeren Belegungszahlen in Krankenhäusern und Kliniken
- das Verbot von Großveranstaltungen und größeren Familienfeiern
Veränderte Ernährungsgewohnheiten
Neben der Küchenhygiene und der Lebensmittelverarbeitung könnten auch veränderte Ernährungsgewohnheiten und Änderungen im Warenverkehr eine Rolle gespielt haben. Beispielsweise waren in der Pandemie-Zeit eher Dauerlebensmittel auf dem Speiseplan, ferner bevorzugten die Menschen regionale Lebensmittel. Zudem wurden die Speisen in größerem Maße individuell zubereitet oder man griff auf Lieferangebote zurück.
Eingeschränkte Reisetätigkeit
Ebenso scheinen die Ausweisung von Risikogebieten und die eingeschränkte Reisetätigkeit ins Ausland die Infektionsraten zu beeinflussen. Sichtbar wird das vor allem bei den mehrheitlich reiseassoziierten viralen Erkrankungen. Gegenüber 2019 verringerte sich die Rate an Dengue- und Chikungunya-Fieber um 86% bzw. 78%. Auch gingen die Meldezahlen für bakteriell verursachte Infektionen drastisch zurück. Paratyphus, Typhus abdominalis und Shigellose waren jeweils um 78%, 77% und 82% gegenüber dem Vorjahr reduziert.
Veranstaltungsverbote und Einschränkungen der Freizeitaktivitäten
Veranstaltungsverbote und Einschränkungen der Freizeitaktivitäten bildeten sich vor allem in der Anzahl der gemeldeten EHEC-Infektionen und Fällen vom hämolytisch-urämischen Syndrom (HUS) ab. Neben dem Konsum von Risikolebensmitteln wie Rohmilch oder nicht durchgegarten Fleischprodukten liegt die Infektionsursache häufig im direkten Tierkontakt, zum Beispiel beim Besuch von Streichelzoos oder Bauernhöfen. Dies war bis zur zwischenzeitlichen Lockerung der Restriktionen – wenn überhaupt – nur eingeschränkt möglich. Bis zur 53. KW 2020 wurden an das RKI insgesamt 58,4% weniger EHEC-Enteritiden und 54,9% weniger HUS-Fälle übermittelt als 2019.