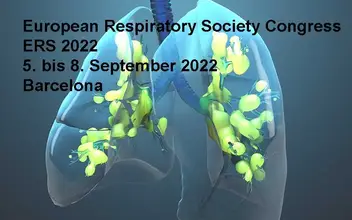Zu Beginn seines Vortrages auf dem Europäischen Internistenkongress (ECIM) in Wiesbaden gab Professor Per M. Hellström, Department of Medical Sciences, Universität Uppsala, zunächst einen Überblick zur gastroösophageale Refluxkrankheit (GERD).
Definition und Hintergründe
GERD ist nach der Montreal-Klassifikation von 2006 definiert als ein Zustand, der auftritt, wenn es zu einem Reflux von Mageninhalt in den Ösophagus oder manchmal auch in die Mundhöhle (inkl. Larynx) oder sogar in die Lungen kommt. Von GERD spricht man laut Klassifikation, wenn es zweimal wöchentlich zu milden Symptomen kommt oder einmal pro Woche zu mittelgradigen bis schweren Symptomen.
GERD ist mit einer Inzidenz von 20% ein häufiges Problem. Etwa 5% aller Konsultationen von Allgemeinmedizinern in den westlichen Industrieländern gehen auf GERD zurück. Die Erkrankung führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität der Betroffenen.
Hellström betonte, dass es keinen Zusammenhang zwischen Helicobacter pylori und einer Ösophagitis gibt.
Symptome und Diagnose
Als typische Symptome nannte Hellström:
- Sodbrennen
- Regurgitation
- Dysphagie
- Brustschmerzen
- Hypersalivation.
Sodbrennen und Regurgitation können zur klinischen Diagnosestellung und Therapie genutzt werden, ohne dass es weiterer Diagnostik bedarf. Die Sensitivität und Spezifität dieser Symptome liegt bei 75 – 83% bzw. 55 – 63%.
Zu den atypischen Symptomen zählen Odynophagie, dentale Erosionen, respiratorische Symptome (z. B. Husten, chronische Laryngitis) und Oberbauchschmerzen.
Endoskopie
Die Endoskopie ermöglicht die direkte Darstellung der mukosalen Läsionen, die durch den Reflux von Magensäure verursacht werden. Allerdings weisen 30 – 70% der GERD-Patienten keine Läsionen bei der Endoskopie auf. Eine Endoskopie solle bei Verdacht auf Strikturen, Barrett-Ösophagus, Adenokarzinom und Alarmsymptomen durchgeführt werden, so Hellström. Weitere Fälle, in denen vom Referenten zu einer Endoskopie geraten wird, sind:
- Typische Symptome, die trotz Therapie mit Protonenpumpeninhibitoren (PPI) zweimal täglich für 4 – 8 Monate, persistieren
- Alter > 50 Jahre und persistierende Symptome
- Follow-up bei Barrett-Ösophagus.
Zur Klassifikation der Schleimhautläsionen wird weiterhin die seit 1999 etablierte Los-Angeles-Klassifikation genutzt, die eine Einteilung in vier Grade (A – D) vornimmt.
Neues zur Pathophysiologie
Säuretaschen
Das Vorhandensein einer Säuretasche (acid pocket) kann das Auftreten von Symptomen begünstigen. Postprandial bildet sich auf dem Speisebrei nahe dem gastroösophagealen Übergang eine Säureschicht, die lange persistieren kann. Vermutlich stellen diese Säuretaschen das Reservoir für den Reflux dar.
Der Referent stellt eine Studie vor, in der Patienten mit einer Säuretasche und einer Hiatushernie untersucht wurden [2]. Die Szintigraphie erlaubt die Darstellung der Säuretasche und mit Hilfe der hochauflösenden Manometrie (HRM) kann die Hiatushernie dargestellt werden. D er Einsatz von PPIs führt in der Studie dazu, dass der Spiegel der Säuretasche im Magen und nicht im Ösophagus zu liegen kommt. Dieser Effekt der PPIs werde durch den Einsatz von Alginaten unterstützt, so Hellstöm.
Therapie mit PPIs
PPIs werden zur Erstlinienbehandlung von erosiver und nicht erosiver Ösophagitis eingesetzt. Die Heilungsrate nach acht Wochen Behandlung beträgt 80- 90%. In der anschließenden Erhaltungstherapie ist bei erosiver Ösophagitis die tägliche Behandlung der Bedarfstherapie vorzuziehen, wie Daten der EROS-Studie zeigen [3]. Bei symptomatischen Patienten ohne Läsionen der Mukosa sei die Bedarfsbehandlung ausreichend, so Hellström.
Vonoprazan als neue Therapieoption?
Vonoprazan ist ein kaliumkompetitiver Säuresekretionshemmer, welcher die H+/K+-ATPase an den Parietalzellen des Magens reversibel und kompetitiv hemmt. Bislang ist der Wirkstoff in Europa nicht erhältlich.
Vonoprazan entfaltet seine Wirkung bereits ab der ersten Einnahme und es kommt für 24 Stunden zur fast maximale Hemmung der H+/K+-ATPase. Abgesehen von einem schnelleren Wirkungseintritt, sei Vonoprazan den herkömmlichen PPIs aber nicht überlegen, so Hellström.
Krebsrisiko bei Barrett-Ösophagus
Bei Patienten mit einem Barrett-Ösophagus besteht kein Risiko für ein ösophageales Adenokarzinom, so lange keine Dysplasie vorliegt. Dies zeigen auch Daten einer Studie, die Hellström präsentierte [4]. Die Studienergebnisse werfen auch die Frage auf, ob eine Rationale für die Überwachung von Patienten mit Barrett-Ösophagus ohne Dysplasie gegeben ist, so der Gastroenterologe. Liegt jedoch eine Dysplasie vor, so solle diese, unabhängig vom Grad der Dysplasie, überwacht werden.
GERD und eosinophile Ösophagitis
Seit Mitte der Neunziger Jahre ist die eosinophile Ösophagitis als eigenständige Erkrankung anerkannt, davor hielt man sie für eine Form von GERD. GERD schädigt die Mukosa und führt zu einer eosinophilen Infiltration. Eine eosinophile Ösophagitis und GERD bedingen sich gegenseitig.
Das Ansprechen auf PPIs bei entsprechender Symptomatik schließt das Vorhandensein einer eosinophilen Ösophagitis nicht aus. Etwa 40% der Patienten mit eosinophiler Ösophagitis sprechen auf PPIs an. Man spricht von PPI-REE (PPI-responsive esophageal esophagitis).
Fazit
Abschließend hob Hellström die wichtigen Punkte seines Vortrages hervor. Dazu zählen:
- Die Säuretasche als neuer Aspekt der Pathophysiologie und in diesem Zusammenhang die Wirkung der Alginate
- PPIs vs. kaliumkompetitive Säuresekretionshemmer
- Vorhandensein bzw. Abwesenheit einer Dysplasie bei Barrett-Ösophagus und Krebsrisiko
- PPI-responsive eosinophile Ösophagitis als neue Entität der eosinophilen Ösophagitis.