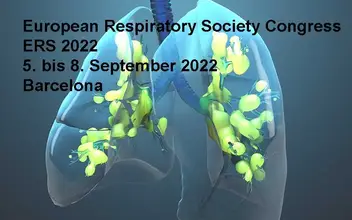Zu Beginn seines Vortrages betonte Professor Dr. Dirk Müller-Wieland, Diabetologe und Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG), die Wichtigkeit von LDL-Cholesterinpartikeln in der Entstehung artherosklerotischer Erkrankungen [1]. Diese Partikel seien „toxisch“ für die Gefäßwände.
Das Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen steigt an, je länger die Gefäßwände durch die LDL-Partikel geschädigt werden. Dieses Konzept sei auch gut, um die Problematik den Patienten zu vermitteln, so Müller-Wieland.
Europäische Dyslipidämie-Leitlinie
Anschließend ging Müller-Wieland auf die Dyslipidämie-Leitlinie der europäischen Kardiologie-Gesellschaft (ESC) und der europäische Atherosklerose-Gesellschaft (EAS) aus dem Jahr 2016 ein [2].
Patienten mit sehr hohem Risiko
Bei der Leitlinie hob der Referent die Gruppe der Patienten mit sehr hohem Risiko hervor. In diese Gruppe werden Patienten mit folgenden Erkrankungen eingeordnet:
- Dokumentierte kardiovaskuläre Erkrankung
- Diabetes mellitus mit Endorganschäden oder einem prominenten Risikofaktor
- Schwere chronische Nierenerkrankung (GFR < 30 ml/min/1,73m²)
- Systematic Coronary Risk Estimation (RISK)-Score ≥ 10%.
Bei diesen Patienten liegt der Zielwert für LDL-Cholesterin (LDL-C) bei < 70 mg/dl. Die Besonderheit in dieser Gruppe ist der Zusatz bei den Zielvorgaben für Patienten mit einem niedrigen Ausgangswert (70 – 135 mg/dl ohne jegliche lipidsenkende Therapie). Hier gibt die Leitlinie eine Senkung von mindestens 50% vor.
Ist Zielwert unter 70 mg/dl ausreichend?
Der Referent bezeichnete den Zielwert von 70 mg/dl als gute Grenze, dennoch stelle sich die Frage, ob man diesen noch tiefer ansetzen solle. Hierzu präsentierte Müller-Wieland verschiedene Studienergebnisse.
Tiefere Zielwerte und kardiovaskulärer Outcome
In der IMPROVE-IT-Studie [3] erhielten Patienten nach akutem Koronarsyndrom eine Therapie mit Simvastatin oder Simvastatin und Ezetimib. Dadurch wurde der LDL-C-Wert in der Gruppe mit Kombinationstherapie auf einen Bereich um 55 mg/dl abgesenkt. Der kardiovaskuläre Outcome und weitere Parameter verbesserten sich dadurch weiter. Diese Daten unterstützen einen tieferen Zielwert, so Müller-Wieland.
Einfluss des LDL-C-Wertes auf atherosklerotische Plaques
Zwei Studien [4, 5] zeigten, dass ein Zielwert um die 70 mg/dl die Progression atherosklerotischer Plaques stoppen kann. Um allerdings eine Regression dieser Plaques zu erreichen, ist ein tieferer Zielwert – unter 50 mg/dl – nötig. Dies ist ein weiteres Argument, was für einen tieferen Zielwert spricht.
PCSK9-Inhibitoren
Die Reduktion des kardiovaskulären Risikos und eine Absenkung des LDL-C auf 30 mg/dl konnte in einer Studie mit dem PCSK9-Inhibitor Evolocumab demonstriert werden [6].
Wirkmechanismus PCSK9-Inhibitoren
Zur Cholesterin-Senkung können PCSK9-Inhibitoren genutzt werden. PCSK9-Inhibitoren hemmen das Enzym PCSK9 (Proproteinkonvertase Subtilisin Kexin Typ 9), welches ein negativer Regulator des LDL-Rezeptors in der Leber ist.
Durch PCSK9-Inhibitoren wird also der Abbau von LDL-Rezeptoren vermindert und es kommt zu einer Reduktion von LDL-C, da dieses in die Hepatozyten aufgenommen wird. In die Leitlinie aus 2016 haben die PCSK9-Inhibitoren erstmals Eingang gefunden. Sie können laut Leitlinie bei Patienten, die nicht ausreichend auf die Kombinationstherapie mit Statinen und Ezetimib angesprochen haben, eingesetzt werden.
Fazit
Abschließend stellte Müller-Wieland fest, dass in Anbetracht der Studienlage ein tieferer Zielwert Sinn machen würde. Es sei auch zu diskutieren, ob eine Gruppe mit extrem hohem Risiko definiert werden sollte. Darin könnten beispielsweise Patienten mit akutem Koronarsyndrom eingeordnet werden.
Ein weiterer diskussionswürdiger Punkt sei die Ansiedlung des Zielwertes. Beispielweise wären ein Zielwert unter 50 mg/dl oder auch die Definition eines Zielbereiches zwischen 20 und 40 mg/dl vorstellbar. Die wissenschaftliche Evidenz spreche dafür, so Müller-Wieland.