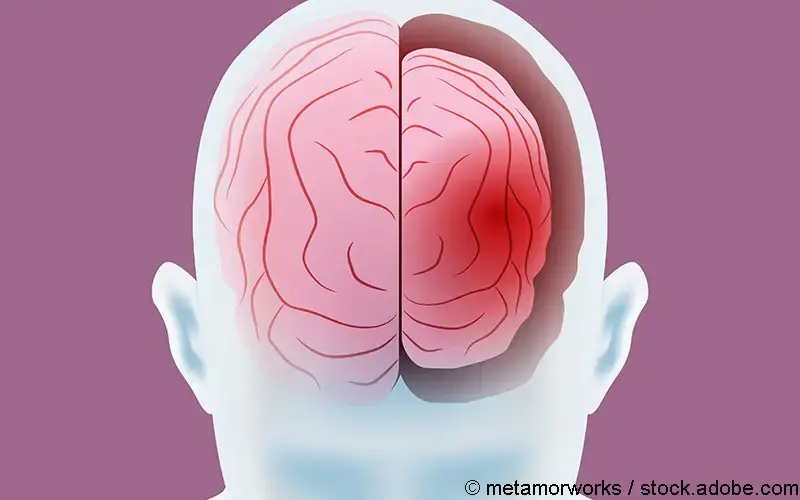
Hintergrund
Traditionell werden bei der Multiplen Sklerose zwei Phasen unterschieden: Eine frühe (primäre) schubförmige bzw. remittierende Phase (relapsing MS [RMS]) und eine späte (sekundäre) progrediente Phase (secondary progressive MS [SPMS]). Bislang ging man davon aus, dass das Fortschreiten der Behinderung in der RMS-Phase vor allem durch neuroinflammatorische Prozesse während der Schubaktivität vorangetrieben wird. Eine schubunabhängige Progression der Behinderung (progression independent of relapse activity [PIRA]) galt als Kennzeichen der SPMS. Mittlerweile mehren sich jedoch die Berichte über PIRA auch bei Patienten mit RMS. Die pathophysiologischen Mechanismen hinter PIRA bleiben jedoch schwer fassbar, auch wenn es plausibel erscheint, dass PIRA mit vermehrten diffusen neuroaxonalen Verlusten in Verbindung steht [1,2].
Ziel: Behinderungsprogression bei MS besser verstehen
Um diese neuroaxonalen Verluste in Zusammenhang mit PIRA bei Patienten mit RMS nachzuweisen und ein besseres Verständnis für die pathophysiologischen Mechanismen der Behinderungsprogression bei Multipler Sklerose zu erlangen, haben Schweizer Wissenschaftler unter der Leitung von Prof. Dr. Cristina Granziera vom Translational Imaging in Neurology (ThINk) am Department of Biomedical Engineering der Universität Basel eine retrospektive Beobachtungsstudie mit RMS-Patienten mit unterschiedlichem Krankheitsverlauf durchgeführt. Die Studie mit dem Erstautor Dr. Alessandro Cagol, ebenfalls Neurologe am ThINK Basel, wurde in JAMA Neurology veröffentlicht.
Patienten in der Studie
In die retrospektive longitudinale Beobachtungsstudie des ThINK-Departements wurden Patienten eingeschlossen, deren Krankheitsverlauf in der Schweizer Multiplen Sklerose Kohorte prospektiv beobachtet wurde. Die Schweizer Multiple Sklerose Kohorte ist eine Multicenter-Studie, die standardisiert demographische und klinische Daten sowie MRT-Scans erhebt und sammelt. Die Wissenschaftler des ThINK werteten die Daten von insgesamt 516 Patienten mit RMS aus, von denen 1904 MRT-Scans vorlagen. Die Patienten waren mehrheitlich weiblich, im Schnitt 41,4 Jahre alt und wiesen einen Behinderungsgrad (Expanded Disability Status Scale Score [EDSS)] von durchschnittlich 2,0 (1,5-3,0) auf. Die Daten stammten aus der Zeit zwischen Januar 2012 und September 2019. Die Follow up-Periode betrugt im Median 3,2 (2,0-4,9) Jahre.
Einteilung der Patienten und Endpunkte
Je nach Krankheitsverlauf während des gesamten Beobachtungszeitraums wurden die RMS-Patienten in folgende Gruppen eingeteilt:
- Ausschließlich Schubaktivität
- Ausschließlich PIRA-Episoden
- Gemischte Aktivität
- Klinisch stabil
Als Endpunkt wurde die durchschnittliche Differenz der jährlichen prozentualen Veränderung (Mean difference in annual percentage change [MD-APC]) des Hirnvolumens/der Hirnrindendicke zwischen den Gruppen definiert. Die Kalkulation erfolgte nach Propensity Score Matching. Die Hirnatrophie-Raten und ihre Assoziation zu Variablen von Interesse wurden mit gemischten Modellen exploriert.
Beschleunigte Hirnatrophie messbar
Bei Patienten mit PIRA konnte im Vergleich zu klinisch stabilen Patienten eine beschleunigte Hirnatrophie, gemessen als erhöhte Rate an Gehirnvolumenverlust (MD-APC -0,36; 95 % CI -0,60 bis -0,12; p=0,02), festgestellt werden. Dabei handelte es sich hauptsächlich um den Verlust grauer Hirnsubstanz in der Großhirnrinde. Zwischen Patienten mit PIRA und Patienten mit Schubaktivität gab es keinen messbaren Unterschied bei den Hirnatrophieraten. Auch Patienten mit Schubaktivität wiesen im Vergleich zu klinisch stabilen Patienten eine erhöhte Atrophie auf (MD-APC -0,18; 95 % CI -0,34 bis -0,02]; p=0,04). Bei ihnen zeigte sich in der Großhirnrinde und in der tief liegenden Grauen Substanz eine beschleunigte Atrophie. Eine in der Radiologie sichtbare Entzündungsaktivität war mit erhöhten Atrophieraten in verschiedenen Gehirnregionen verbunden.
Fazit
Die schubunabhängige Krankheitsprogression bei RMS spielt sich in der Regel im Verborgenen ab und wird erst in der Rückschau erkannt, wenn sich der Behinderungsgrad der Patienten ohne Schubaktivität verschlechtert hat. Die Schweizer Wissenschaftler zeigten, dass die PIRA-Episoden mit erhöhten Hirnatrophieraten, insbesondere in der kortikalen grauen Hirnsubstanz, assoziiert sind. Diesen unwiederbringlichen Hirnverlust gilt es durch eine verbesserte Früherkennung und zeitnahe Optimierung der Therapie zu verhindern, appellieren die Autoren der Studie und fordern Untersuchungen, die die potenziellen Vorteile von Eskalations- und Induktionstherapien bei RMS-Patienten mit PIRA evaluieren.










