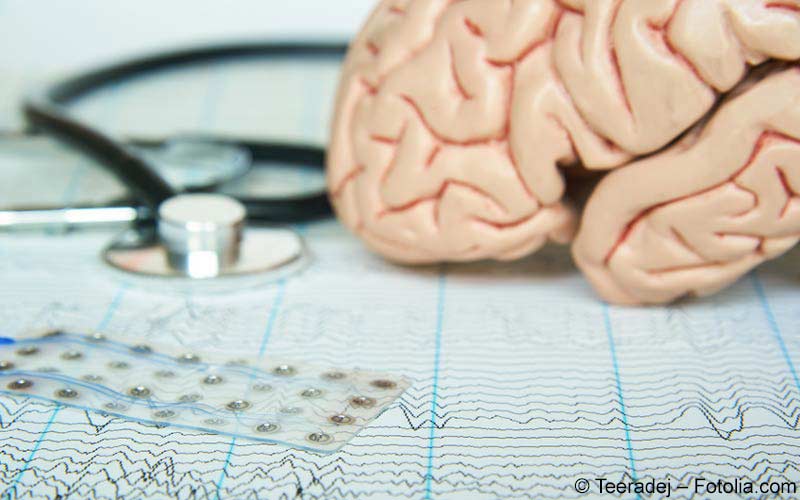
Hintergrund
Lange schon wird vermutet, dass Epilepsie zyklischen Rhythmen unterliegt, wobei die Anfallshäufigkeit über Wochen, Monate oder sogar Jahre in regelmäßigen Abständen zu- und abnimmt. Bisher fanden Forscher keine Erklärung für die sehr langen Anfallsmuster und man vernutet hormonelle Zyklen oder Umweltfaktoren. Untersuchungen liegen bisher nur über relativ kurze Zeiträume oder nur an kleinen Patientenzahlen vor.
Zielsetzung
Diese Studie eines australischen Forscherteams zielte darauf ab, die Stärke und Prävalenz von Anfallszyklen auf mehreren Zeitskalen über eine große Gruppe von Patienten mit Epilepsie hinweg zu quantifizieren [1].
Methodik
Karoly und Kollegen von der University of Melbourne, Australien, nutzten für diese retrospektive Kohortenstudie die beiden umfangreichsten Datenbanken für Anfälle beim Menschen, NeuroVista (Melbourne, Australien) und SeizureTracker (USA) und analysierten die Daten von Patienten mit Epilepsie mithilfe von Techniken aus der Zirkularstatistik, um Auftreten und Häufigkeit von Anfallsereignissen besser zu charakterisieren.
In der NeuroVista-Datenbank finden sich Daten zu Patienten mit schwer behandelbarer fokaler Epilepsie. Die eingegebenen Informationen in der SeizureTracker-Erfassung werden von den Teilnehmern selbst ausgewählt und erfüllen keine bestimmten Kriterien. Für die aktuelle Auswertung berücksichtigten die Forscher die Daten von Patienten mit mindestens 30 bzw. 100 Anfällen.
Das Vorhandensein von Anfallszyklen über mehrere Zeitskalen untersuchten die Forscher unter Verwendung der mittleren resultierenden Länge (R-Wert). Die zirkulare Gleichförmigkeit prüften sie mithilfe des Rayleigh- und des Hodges-Ajne-Tests und bestätigten die Ergebnisse des Rayleigh-Tests für die Anfallsphase mit Monte-Carlo-Simulationen.
Ergebnisse
Karoly und Kollegen nutzten für die Analyse Daten von zwölf Personen aus der NeuroVista-Studie (Daten vom 10. Juni 2010 bis 22. August 2012) und von 1.118 Personen aus der SeizureTracker-Datenbank (Daten vom 01. Januar 2007 bis 19. Oktober 2015).
Elf (92%) von zwölf Patienten in der NeuroVista-Kohorte und mindestens 891 (80%) der 1.118 Patienten in der SeizureTracker-Kohorte zeigten eine zirkadiane (24 Stunden) Modulation ihrer Anfallsraten.
In der NeuroVista-Kohorte wies ein Patient (8%) einen exakt wöchentlichen Zyklus auf, zwei weitere Patienten (17%) einen annähernd wöchentlichen Zyklus. In der SeizureTracker-Kohorte zeigten sich je nach statistischem Modell bei 77 (7%) bis 233 (21%) der 1.118 Patienten starke Korrelationen mit einer klaren 7-Tage-Periode.
In der NeuroVista-Kohorte traten die Anfälle zweier Patienten (17%) im zweiwöchigen Zyklus auf. In der SeizureTracker-Kohorte hatten zwischen 151 (14%) und 247 (22%) Patienten signifikante Anfallszyklen, die länger als 3 Wochen waren.
Bestimmte Anfallszyklen traten bei Männern und Frauen gleichermaßen auf und die Anfallsraten waren gleichmäßig über alle Wochentage verteilt.
Fazit
Die Autoren betonen, dass die Anfälle festen zeitlichen Mustern folgen, patientenspezifisch und weiter verbreitet sind als bisher bekannt. Sie stimmen mit dem allgemeinen Konsens überein, dass die meisten Epilepsieerkrankungen täglichen Schwankungen unterliegen. Variationen in der Anfallsrate sind von großer klinischer Bedeutung. Das Erkennen und Verfolgen von Anfallszyklen auf einer patientenspezifischen Basis sollte eine Routine beim Epilepsiemanagement sein. Damit könnte die Patientensicherheit erhöht und der Einsatz von Medikamenten optimiert werden.
Limitationen der Studie
Dass Patienten in der SeizureTracker-Studie eigenständig und möglicherweise nicht über alle Anfälle berichteten, könnten die Studienergebnisse verzerrt habe, geben die Autoren zu bedenken. Eine weitere Schwäche der Daten könnte die fehlende Erfassung von Schlaf- und Wachzeiten sowie von Zeitpunkten der Medikamenteneinnahme sein.
Die Studie wurde vom australischen National Health and Medical Research Council finanziert.









