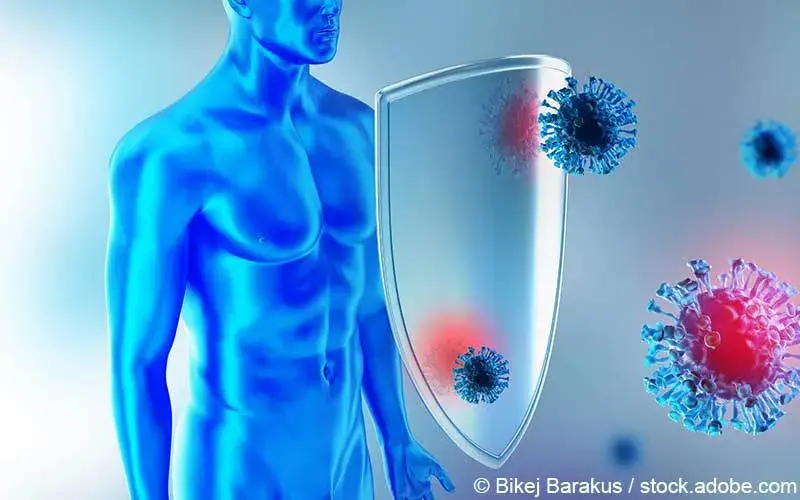
Die Coronavirus-Krankheit 19 (coronavirus disease-19 [COVID-19]), verursacht durch ein schweres akutes Atemwegssyndrom (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 [SARS-CoV-2]), führte weltweit zum Tod von Millionen von Menschen. Bisher zugelassene Corona-Impfstoffe induzierten bei der Mehrheit der Geimpften eine robuste Immunantwort gegen SARS-CoV-2. Bei vielen immungeschwächten Menschen zeigte sich jedoch eine verminderte Wirksamkeit.
Eine solche Population stellen Patienten, die sich einer Behandlung von Leukämie unterziehen, dar, da ihre Behandlungsschemata neben malignen häufig auch gesunde Immunzellen, insbesondere B-Zellen, schädigen.
„In der Klinik sehen wir viele Krebspatienten, die nach der Impfung mit verfügbaren SARS-CoV-2-Impfstoffen keine ausreichenden humoralen Immunantworten entwickeln", sagte Prof. Juliane Walz, Leiterin der Abteilung für peptidbasierte Immuntherapien und medizinische Direktorin der Klinischen Kooperationseinheit (KKE) Translationale Immunologie des Universitätsklinikums Tübingen. „Diese Patienten haben somit ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf von COVID-19."
Viele Chemotherapien und einige Immuntherapien zerstören B-Zellen, diejenigen Immunzellen, die für humorale (Antikörper-vermittelte) Reaktionen verantwortlich sind. Derzeit zugelassene SARS-CoV-2-Impfstoffe beruhen stark auf humoralen Reaktionen, die bei Patienten mit einem B-Zell-Mangel beeinträchtigt sein können. Eine Möglichkeit, dies zu kompensieren, besteht darin, die Reaktion von T-Zellen, einer anderen Art von Immunzellen, zu verstärken.
CoVac-1 ist ein peptidbasierter Impfstoffkandidat, der aus sechs von SARS-CoV-2 abgeleiteten T-Zellepitopen besteht, die aus verschiedenen viralen Proteinen, nicht beschränkt auf Spike-Proteine, gewonnen werden. Diese sind mit dem Toll-like-Rezeptor 1/2 Agonist XS15 als Adjuvans kombiniert, der in Montanid ISA51 VG emulgiert ist. Ziel ist es, eine tiefgreifende T-Zell-Immunität gegenüber SARS-CoV-2 zum Schutz vor COVID-19 zu induzieren.
Die Forscher testeten die Sicherheit und vorläufige Wirksamkeit von CoVac-1 bei Personen ohne Immunschwäche (NCT04546841) und fanden heraus, dass alle Geimpften drei Monate nach der Impfung bei minimalen systemischen Nebenwirkungen robuste T-Zell-Reaktionen aufrechterhielten, einschließlich Reaktionen gegen Omicron und andere besorgniserregende SARS-CoV-2-Varianten [1].
Zielsetzung
Diese Ergebnisse der Phase-I-Studie bildeten die Grundlage für eine klinische Phase-I/II-Studie (B-pVAC-SARS-CoV-2), in der die Studiengruppe am Universitätsklinikum Tübingen die Wirksamkeit des Impfstoffs bei immungeschwächten Patienten untersuchte. Die vorläufigen neuen Erkenntnisse zur Impfung mit CoVac-1 wurden auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) vorgestellt [2,3].
Methodik
In dieser laufenden multizentrischen offenen klinischen Phase-I/II-Studie wurde die Sicherheit und Immunogenität der Multipeptid-Impfung zur Vorbeugung einer COVID-19-Infektion bei Erwachsenen mit B-Zell-/Antikörpermangel untersucht.
Im Phase-I-Teil der Studie rekrutierten die Forscher Patienten mit einem kongenitalen oder erworbenem B-Zell-Mangel, darunter Patienten mit Leukämie oder Lymphom, die nicht mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Die Patienten erhielten eine Einzeldosis CoVac-1 subkutan und wurden bis zu sechs Monate lang bezüglich der Therapiesicherheit und Immunogenität überwacht. Bemerkenswert ist, dass 64% der Patienten in dieser Studie zuvor mit einem zugelassenen SARS-CoV-2-Impfstoff geimpft worden waren, der keine humorale Immunantwort hervorgerufen hatte.
Für 28 Tage nach der Impfung des ersten Patienten, war eine Zwischenanalyse geplant, in der das Data Safety Monitoring Board (DSMB) die Datenlage zur Sicherheit und Immunogenität überprüfen sollte. Bei Vorliegen einer unzureichenden Immunantwort, sollte in einem zusätzlichen Studienteil eine zweite Impfung an Tag 42 erfolgen.
Eine ausreichende Immunogenität nach einer Impfdosis war definiert als das Vorliegen einer T-Zell-Antwort auf mindestens ein CoVAC-1-Impfstoffpeptid am Tag 28 bei ≥ 80% der Studienteilnehmer, mit nachgewiesener allgemeiner Fähigkeit zu antigenspezifischen T-Zell-Antworten (Nachweis von T-Zell-Antworten auf Epstein-Barr-Virus/ Cytomegalovirus [EBV/CMV]-Kontrollpeptide), bewertet im Interferon gamma (IFN-γ) ELISpot-Test.
Im Phase-II-Teil der Studie sollen 40 Probanden eine subkutane Injektion CoVac-1 erhalten und, abhängig von den in Phase 1 erhobenen Daten, gegebenenfalls eine zweite Impfung an Tag 42.
Ergebnisse
Im Phase-I-Teil der Studie rekrutierten die Forscher 14 Patienten mit einem B-Zell-Mangel, darunter 12 Patienten mit Leukämie oder Lymphom. 14 Tage nach der Impfung wurden bei 71% der Patienten T-Zell-Immunantworten beobachtet, die 28 Tage nach der Impfung auf 93% der Patienten anstiegen. Impfstoffinduzierte T-Zell-Antworten wurden durch multifunktionale CD4-positive T-Helferzellen vermittelt.
Die Forscher fanden, dass die CoVac-1-induzierten T-Zell-Reaktionen die Spike-spezifischen T-Zell-Reaktionen übertrafen, die bei B-Zell-defizienten Patienten nach der Impfung mit mRNA-Impfstoffen beobachtet wurden. Die T-Zell-Reaktionen nach der Impfung mit CoVac-1 übertrafen die von nicht immungeschwächten Personen nach einer SARS-CoV-2-Infektion.
Die Rekrutierung für den Phase-II-Teil der Studie läuft.
Fazit
„Die CoVac-1-induzierte T-Zell-Immunität ist weitaus intensiver und breiter aufgestellt, da sie auf andere virale Komponenten gerichtet ist als mRNA-basierte oder adenovirale vektorbasierte Impfstoffe. Letztere sind auf das Spike-Protein beschränkt und daher anfällig für Aktivitätsverlust aufgrund viraler Mutationen", erklärte Claudia Tandler, Doktorandin an der Universität Tübingen.
„CoVac-1 wurde entwickelt, um eine breite und langanhaltende SARS-CoV-2-T-Zell-Immunität selbst bei Personen, deren Immunsystem beeinträchtigt ist und keine ausreichende Immunität gegen einen derzeit zugelassenen Impfstoff aufbauen kann, zu induzieren, und diese Hochrisikopatienten vor einem schweren Verlauf von COVID-19 zu schützen", sagte Walz.
Die Forscher bereiten derzeit eine klinische Phase-III-Studie vor, um CoVac-1 in einer größeren Population immungeschwächter Personen zu bewerten. Walz hofft, dass CoVac-1 schon Anfang 2023 zugelassen werden könnte [4].
Die Studie ist unter der Nummer NCT04954469 bei ClinicalTrials.gov registriert und wurde vom Universitätsklinikum Tübingen finanziert.













