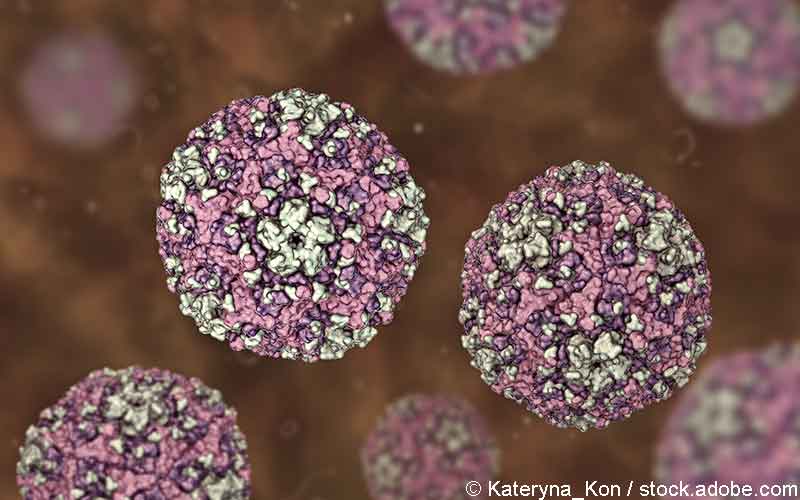
Hintergrund
Das maligne Melanom ist der Hauttumor mit der höchsten Metastasierungsrate und für mehr als 90% aller Sterbefälle an Hauttumoren verantwortlich. Etwa zwei Drittel aller malignen Melanome werden so früh erkannt, dass sie durch eine Operation entfernt werden können und der Patient geheilt ist. Wenn sich ein Melanom nachweislich bereits im Körper ausgebreitet hat, und eine komplette Entfernung der Metastasen nicht möglich ist, wird die Behandlung aufwändiger und die Heilungschancen sind schlechter [1].
Die virale Onkolyse ist eine potenziell spezifische und wirksame Form der Krebsbekämpfung, bei der die Viren gezielt Tumorgewebe befallen und zerstören. Shafren und Kollegen zeigten, dass menschliche Melanomzellen erhöhte Spiegel an interzellulärem Adhäsionsmolekül ICAM-1 und dem Zerfallsbeschleunigungsfaktor (decay-accelerating factor [DAF]) exprimieren und sehr anfällig für eine schnelle virale Onkolyse durch Infektion mit dem RNA-Virus Coxsackievirus A21 (CVA21, einem Erkältungsvirus) waren. Nach intratumoraler Injektion infizierte CVA21 in einem murinen Xenofgraft-Modell selektiv ICAM-1-exprimierende Tumorzellen und führte zur Tumorzelllyse und einer systemischen immunvermittelten Antitumorreaktion [2].
Zielsetzung
Wissenschaftler um Dr. Robert Andtbacka vom Huntsman Cancer Institute in Salt Lake City in den USA untersuchten die Aktivität des intratumoralen lebenden CVA21 (V937) bei Patienten mit inoperablem Melanom im Stadium IIIC oder IV. Die Publikation über die Studienergebnisse erschien vor Kurzem im Journal of Clinical Oncology [3].
Methodik
Die Phase-II-Studie „CALM“ war eine multizentrische, offene, zweistufige, einarmige klinische Studie zur Untersuchung der Wirksamkeit und Sicherheit von CVA21. In der Studie wurden Patienten mit histologisch nachgewiesenem Melanom im Stadium IIIc oder Stadium IV, die nicht für eine kurative Operation in Frage kamen und einen oder mehrere Tumore trugen, die für direkte Injektionen zugänglich waren, behandelt. Mindestens eine Läsion musste nach RECIST 1.1-Kriterien messbar sein.
Die Patienten erhielten CVA21 bis zu einer Gesamtdosis von 3 × 108 TCID50 (50% tissue culture infectious dose, der Infektionsdosis in Gewebekultur) in einem maximalen Volumen von 4,0 ml als intratumorale Injektion. In der Hauptstudie (NCT01227551) wurden maximal zehn Injektionen im Zeitraum von 127 Tagen verabreicht.
Patienten, die nach 18 Wochen (Tag 127) Hinweise auf eine biologische Aktivität, das heißt eine Entzündungsreaktion im Tumor und/oder eine mindestens stabile Erkrankung zeigten, konnten die Behandlung in einer Verlängerungsstudie (NCT01636882) fortsetzen, in der sie weiterhin alle drei Wochen bis zu insgesamt einem Jahr seit der ersten Injektion CVA21 intratumoral erhielten.
Der Ansprech- und Progressionsstatus wurde vor Beginn der Behandlung und an den Tagen 43, 85, 127 und 169 und danach in 12-wöchentlichen Intervallen bis zum Fortschreiten der Krankheit mittels kontrastverstärkter Computertomographie oder Magnetresonanztomographie und/oder direkte Messung mit einer Schublehre (und gegebenenfalls Ultraschallunterstützung) beurteilt und anhand immunbezogener Ansprechbewertungskriterien für solide Tumoren (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors [irRECIST]) kategorisiert. Nach zwei Jahren konnten die Intervalle auf sechs Monate erhöht werden.
Weitere Bewertungen umfassten die Überwachung unerwünschter Ereignisse und Serumspiegel von V937 sowie von Anti-V937-Antikörpertitern. Der primäre Wirksamkeitsendpunkt war der Prozentsatz der Studienteilnehmer mit immunbedingtem progressionsfreiem Überleben (irPFS) nach sechs Monaten gemäß irRECIST. Der sekundäre Wirksamkeitsendpunkt war der Prozentsatz der Teilnehmer mit dauerhaftem Ansprechen.
Ergebnisse
In die Studie wurden 57 Patienten eingeschlossen. Der primäre Endpunkt für die Wirksamkeit, die irPFS-Rate nach sechs Monaten, betrug 38,6% (95%-Konfidenzintervall [KI] 26,0 bis 52,4). Die dauerhafte Ansprechrate (teilweises oder vollständiges Ansprechen für mindestens sechs Monate) betrug 21,1%. Die beste Gesamtansprechrate (vollständiges plus partielles Ansprechen) betrug 38,6% (unbestätigt) und 28,1% (bestätigt).
Eine Regression des Melanoms wurde auch bei nicht injizierten Läsionen beobachtet. Basierend auf einer Kaplan-Meier-Schätzung betrug nach zwölf Monaten das PFS 32,9% (95%-KI 19,5 bis 46,9) und das Gesamtüberleben 75,4% (95%-KI 62,1 bis 84,7).
Es traten keine behandlungsbedingten Nebenwirkungen mindestens dritten Grades auf. Virale RNA wurde innerhalb von dreißig Minuten nach der Verabreichung im Serum nachgewiesen. Neutralisierende Antikörpertiter stiegen nach Tag 22 bei allen Patienten auf > 1:16 an, ohne dass dies Auswirkungen auf das klinische oder immunologische Ansprechen hatte.
Fazit
Die Autoren gehen davon aus, dass ihre Publikation zum ersten Mal die Ergebnisse einer Behandlung von Patienten mit Melanom mit intratumoralem V937 beschreibt. Sie betonen, dass eine Regression sowohl injizierter als auch nicht injizierter Läsionen (beispielsweise in Lunge und Leber) auftrat, was auf eine systemische Antitumorwirkung hinweist. V937 wurde gut vertragen.
Die Autoren der Publikation meinen, die Ergebnisse sollten Anlass zu weiteren Untersuchungen zur Behandlung von Patienten mit inoperablem Melanom und anderen Krebsarten mit V937 geben. Studien zu Kombinationsansätzen von V937 mit Immuncheckpoint-Inhibitoren laufen bereits.
Die Hauptstudie ist unter der Nummer NCT01227551 und die Erweiterungsstudie unter der Nummer NCT01636882 bei ClincalTrials.gov registriert. Sie wurden von der Firma Viralytics Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Merck & Co, finanziert.












