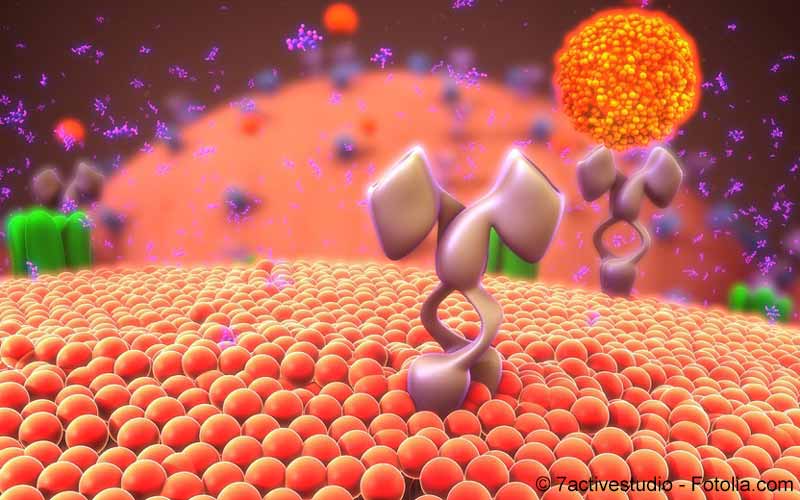Hintergrund
Die Darmmukosa ist als Grenzschicht zwischen Körperinneren und Außenwelt stets in Kontakt mit körperfremden Substanzen. Darunter können sich auch erbgutschädigende (genotoxische) Stoffe befinden, wie beispielsweise Glukosinolate, die in verschiedenen Kohlarten zu finden sind. Über eine Schädigung der DNA verursachen diese Substanzen Mutationen in den Darm-Stammzellen und können so zur Entstehung von Darmkrebs führen.
DNA-Reparaturmechanismus
Wenn die Darm-Stammzellen eine Erbgutschädigung frühzeitig entdecken, gelingt es ihnen meist, über den DNA Reparaturmechanismus eine Krebsentstehung zu verhindern, indem sie die Schäden im Erbgut beheben oder die Apoptose der Zelle einleiten. Bei der Früherkennung der Schäden haben die Zellen dabei offenbar Unterstützung vom angeborenen Immunsystem, wie eine aktuelle Studie zeigt.
Zielsetzung
Die Studie sollte zeigen, ob genetisch veränderte Mäuse, die abschaltbare Interleukin-22 Rezeptoren aufweisen, ein höheres Darmkrebsrisiko aufweisen, wenn sie mit erbgutschädigenden Substanzen in Kontakt kommen, als Wildtyp-Mäuse, die über intakte IL-22 Rezeptoren verfügen. Ziel der Studie war es zu überprüfen, ob und wie das Immunsystem zur Verhinderung von Darmkrebs beiträgt.
Methodik
Wildtyp-Mäuse mit intakten IL-22 Rezeptoren, Mäuse ohne IL-22 Rezeptoren und ein neues Mausmodell mit an- und abschaltbaren IL-22 Rezeptoren in den Darm-Stammzellen wurden erbgutschädigenden Stoffen ausgesetzt. Die Darmkrebsraten sowie die histologischen, molekularbiologischen und genetischen Untersuchungsergebnisse beider Gruppen wurden verglichen.
Spezialdiät
Glukosinolate sind genotoxische Substanzen, die in zahlreichen Kohlarten in der Nahrung vieler Menschen und Tiere natürlicherweise vorkommen. Ausgehend von der Hypothese, dass das Immunsystem Genotoxine früh erkennt und durch sie aktiviert wird, wurden Wildtyp-Mäuse mit einer Glukosinolat-freien Diät gefüttert, um zu überprüfen, ob das Fehlen dieses Genotoxins Einfluss auf die IL-22 Produktion der Tiere hat.
Ergebnisse
Die Mäuse mit den intakten IL-22 Rezeptoren entwickelten deutlich seltener Darmtumoren als die Mäuse ohne oder mit veränderten IL-22 Rezeptoren. Mithilfe des neuen Mausmodells (an- und abschaltbare IL-22Rezeptoren) konnten der Einfluss weiterer Promotoren (z. B. Entzündungen oder Infektionen) der Tumorgenese bei diesem Ergebnis ausgeschlossen werden.
Identifizierung der Immunzellen
Die histologischen, molekularbiologischen und genetischen Untersuchungsergebnisse zeigten, dass bei den Wildtyp-Mäusen die innaten lymphoiden Zellen der Gruppe 3 (ILC-3) und gamma-delta-T-Zellen über die Ausschüttung von IL-22 die Expression des DNA-Reparaturmechanismen in den mutierten Stammzellen förderten. Bei den veränderten Mäusen war dieser regulative Mechanismus nicht nachweisbar.
Immunzellen als Sensoren
Die Glukosinolat-freie Diät hatte zur Folge, dass die entsprechenden Mäuse kaum noch Interleukin-22 produzierten. Darüber hinaus war die Expression des DNA-Reparaturmechanismus in den Stammzellen dieser Mäuse deutlich reduziert und die DNA-Reparatur deutlich eingeschränkt.
Fazit
Die Autoren schließen aus diesen Ergebnissen, dass die ILC-3 und gamma-delta-T-Zellen in der Lage sind Genotoxine zu erkennen und zeitnah mit der Bildung und Ausschüttung von IL-22 zu reagieren. IL-22 fördert dann eine frühzeitige und ausreichende Expression des DNA-Reparaturmechanismus in den Stammzellen und trägt so zur Verhinderung der Tumorgenese bei.