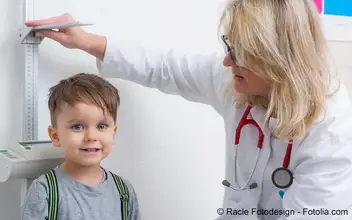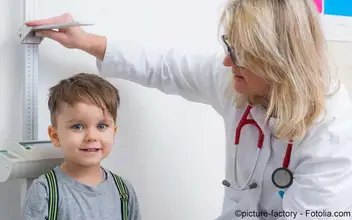Jedes Jahr sterben in Deutschland etwa 80 normal und gesund erscheinende Kinder plötzlich und unerwartet während des Schlafs, ohne dass ein eindeutiger medizinischer Grund gefunden wird. Die meisten Fälle dieses plötzlichen Kindstods (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) treten im Alter zwischen zwei und vier Monaten auf, wobei Jungen 1,5-Mal häufiger betroffen sind als Mädchen [1]. Die gegenwärtige Vermutung der Fachleute ist, dass der plötzliche Kindstod ein multifaktorielles Geschehen ist. Ein akzeptiertes Modell ist das „Dreifache Risikomodell“, demzufolge ein Säugling nur dann am plötzlichen Kindstod verstirbt, wenn die Risikofaktoren 1) gefährdetes Kind (z. B. aufgrund eines genetischen Defekts), 2) kritische Entwicklungsphase (z. B. Reifeprozesse an Herz und Lunge) und 3) exogener Stressfaktor gleichzeitig auftreten.
Viele Theorien zur SIDS-Ursache
Zwar konnten in den letzten Jahrzehnten dank intensiver Forschung verschiedene Risikofaktoren, wie beispielsweise die Bauchlage beim Schlafen, eine Überhitzung aufgrund z. B. zu warmer Kleidung sowie Rauchen während der Schwangerschaft, identifiziert werden [2], die Ursache für SIDS ist allerdings unbekannt. Bekannt dagegen ist, dass betroffene Säuglinge aufgrund eines gestörten Schutzreflexes bei verlegten Atemwege nicht angemessen reagieren und an einer Hypoxie versterben. Theorien hierfür gibt es viele. Mögliche Ursachen sind z. B. eine gestörte Funktion des Atemzentrums, Gendefekte, Infektionen oder eine fehlerhafte Funktion des aufsteigenden retikulären Aktivierungssystems [3,4].
Das Enzym Butyrylcholinesterase
Schon seit längerem wird vermutet, dass das cholinerge System bei SIDS eine Rolle spielen könnte. Beeinflusst wird dieses System durch die Butyrylcholinesterase (BChE, Pseudocholinesterase) und Acetylcholinesterase (AChE), denn diese beiden Enzyme bauen Acetylcholin, den wichtigsten Neurotransmitter im parasympathischen Nervensystem. Vorhanden sind beide Esterasen in verschiedenen Geweben, wobei BChE eine wichtige Rolle im Erregungsweg des Gehirns zu spielen scheint. Ein Mangel könnte daher dazu führen, dass der betroffene Säugling bei aussetzender Atmung nicht mehr aufwacht. Über die Bestimmung der BChE- und AChE-Aktivität ist es daher möglich, festzustellen, ob sich das cholinerge System im Gleichgewicht befindet.
Cholinerges System als Ursache für plötzlichen Kindstod
Studien, die die Enzyme Butyrylcholinesterase und Acetylcholinesterase untersuchen, gibt es jedoch nur wenige. Eine davon ist die Studie von Dick aus dem Jahr 2008, in der 28 an SIDS verstorbene Säuglinge leicht niedrigere (nicht signifikant) AChE-Werte aufwiesen als andere Säuglingsgruppen [5]. Livolsi dagegen fand zwei Jahre später, im Jahr 2010, [6] einen signifikant erhöhten AChE-Spiegel im Blut. Eine niedrige BChE-Aktivität dagegen ist, wie bereits mehrere Studien nachweisen konnte, mit schweren systemischen Entzündungen sowie einer signifikant höheren Sterblichkeit nach Sepsis und kardialen Ereignissen verbunden.
Die Butyrlycholinesterase-Pilotstudie
Aus diesem Grund wollten die Biochemikerin Camel Therese Harrington und ihr Team vom Kinderkrankenhaus Westmead in Sydney in einer Fall-Kontroll-Studie überprüfen, ob auch bei an SIDS verstorbenen Säuglingen zum Zeitpunkt der Geburt die BChE-Aktivitätswerte verändert waren [7]. Für ihre Untersuchung verglichen die Wissenschaftler daher Blutproben, die routinemäßig zwei bis drei Tage nach der Geburt durch einen Fersenstich (Guthrie-Test) entnommen worden waren, auf die BChE-spezifische Aktivität (BChEsa). Insgesamt analysierten sie so die Proben von 56 verstorbenen Kindern (26 an SIDS, 30 an anderen Ursachen) sowie 545 Kontrollproben, wobei das mittlere Sterbealter für SIDS-Fälle 15,7 (± 8,1) Wochen (Bereich 4-35 Wochen) und das für Nicht-SIDS-Fälle 23,5 (± 30) Wochen (Bereich 1-103 Wochen) betrug.
Niedrigere Butyrylcholinesterase-Aktivität
Bei Vergleich der Proben zeigte sich, dass BChEsa bei Säuglingen, die später am plötzlichen Kindstod verstarben, signifikant niedriger war als bei Kindern aus der Non-SIDS- oder der Kontrollgruppe. So bestand in den durchgeführten konditionalen logistischen Regressionsmodellen bei an SIDS verstorbenen Kindern ein starker Hinweis auf eine Assoziation zwischen niedriger BChEsa und dem Tod (kalkulierte Odds Ratio [OR]=0,73 pro U/mg, 95%-Konfidenzintervall [KI] 0,60-0,89, p=0,0014). In der Non-SIDS-Gruppe dagegen ergab sich kein Hinweis auf einen linearen Zusammenhang (OR=1,001 pro U/mg, 95%-KI 0,89-1,13, p=0,99). Eine Assoziation zwischen einem der Prädiktoren (BChEsa, Geschlecht und Todesursache) und dem Alter beim Tod dagegen fanden die Wissenschaftler weder in univariablen noch in multivariablen Modellen.
Mehr SIDS-Studien zum Thema
Harrington und Team vermuten, dass durch die niedrige Butyrylcholinesterase-Aktivität verfügbares Acetylcholin abnimmt und dies die Erregungsreaktion auf eine gegebene Umweltherausforderung, wie beispielsweise eine Infektion oder Atemstillstand, beeinträchtigt. Sie hoffen, dass in Zukunft die BChEsa als Biomarker für die SIDS-Anfälligkeit eines Säuglings verwendet werden kann. Allerdings gibt es vorher noch einiges zu tun. Zum einen analysierten Harrington und Team nur die Butyrylcholinesterase-Aktivität aus dem peripheren Blut, weswegen in einer weiteren Studie die Enzymaktivität im Gehirn überprüft werden müsste. Zudem fehlen Untersuchungen zur Aktivität z. B. der Acetylcholinesterase und zur BChEsa bei gesunden Babys.
Einschränkungen der Butyrlycholinesterase-Pilotstudie
Auch handelt es sich bei der vorliegenden Untersuchung um eine Pilotstudie mit einer sehr kleinen Stichprobe, die zudem weitere Limitationen aufweist. Zum einen weicht das Alter der untersuchten Kinder stark voneinander ab: Waren die Kinder aus der Non-SIDS-Gruppe bei ihrem Tod zwischen einer Woche und knapp zwei Jahre alt, verstarben die Säuglinge aus der plötzlichen-Kindstod-Gruppe in einem Alter von 4 und 35 Wochen. Zum anderen schlossen die Autoren sechs Messwerte aus, da die Ergebnisse unterhalb der Standardkurve lagen.
Des Weiteren unterscheiden sich die Messwerte sehr stark, sodass eine Zuordnung zur SIDS- oder Kontrollgruppe mit diesen allein nicht möglich ist. Die Proben waren zudem zum Zeitpunkt der Studie mehr als zwei Jahre alt und müssen daher nicht unbedingt die Butyrylcholinesterase-Aktivität zum Zeitpunkt der Geburt widerspiegeln. Es wurde BChEsa zum Zeitpunkt des Todes nicht bestimmt. Auch postnatale Einflüsse wirken sich jedoch auf die Cholinesterasen und das autonome Nervensystem aus. Außerdem ergaben sich Schwierigkeiten beim Vergleich der BChEsa-Ergebnisse mit den bekannten Referenzintervallen aufgrund unterschiedlicher Einheiten.