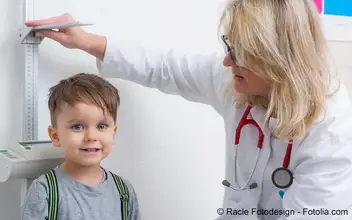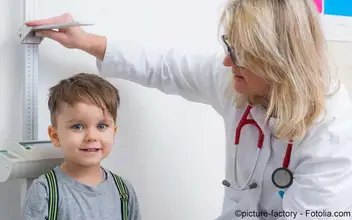Die Jugend ist eine sehr prägende Zeit in der Entwicklung des menschlichen Gehirns. Das Gehirn strukturiert sich neu und organisiert sich funktionell um. Die Umwelt spielt dabei eine wichtige Rolle. Wie sich das Gehirn strukturieren und auf welche Stimuli es wie reagieren wird, kann dadurch möglicherweise entscheidend beeinflusst werden.
Soziale Medien haben in den letzten Jahren die Entwicklung von Jugendlichen deutlich verändert – vielleicht auch die ihrer Gehirne. Im Vergleich zu den Generationen vor ihnen können sie rund um die Uhr sozial mit anderen interagieren. Das führt zu unvorhersehbarem und stetigem sozialen Input in einer Phase, in der gerade das Gehirn besonders sensibel auf soziale Belohnungen aber auch Bestrafungen reagiert. Likes, Benachrichtigungen und private Nachrichten können jederzeit soziales Feedback bieten. Das kann dazu führen, dass Jugendliche konditioniert werden, ihre sozialen Medien habituell zu überprüfen, in der Hoffnung, dieses zu erhalten.
In früheren Studien zeigte sich beispielsweise, dass 78% der 13- bis 17-Jährigen mindestens stündlich ihre elektronischen Endgeräte überprüfen. Etwa 46% der gleichen Altersgruppe sind mehr oder weniger durchgängig online. Das lässt Jugendliche möglicherweise besonders anfällig werden für sogenanntes gewohnheitsmäßiges Kontrollverhalten (Habitual Checking Behavior), weil sie ständig soziale Belohnung oder Bestrafung erwarten. Langfristig könnte das dazu führen, dass Jugendliche sich weniger in kognitiver Kontrolle üben und auch ihr Verhalten schlechter regulieren können.
Inwieweit sich Habitual Checking Behavior sichtbar auf das Gehirn auswirkt, wollte ein nordamerikanisches Forschungsteam wissen. Ihre Ergebnisse haben sie im Journal »JAMA Pediatrics« veröffentlicht.
Zielsetzung
Ziel der Studie war herauszufinden, ob die Hirnentwicklung beeinflusst wird, wenn Jugendliche viel Zeit in den sozialen Medien verbringen. Dabei interessierte das Forschungsteam vor allem, ob sich das Gehirn funktional anders entwickelt. Die Wissenschaftler vermuteten, dass regelmäßiges Nutzen sozialer Medien Jugendliche für soziales Feedback empfänglicher macht. Das würde sich in der neuronalen Aktivität in verschiedenen Regionen, die für Motivation, affektive Salienz und kognitive Kontrolle zuständig sind, zeigen. Im Gegenteil dazu müssten Jugendliche, die weniger in sozialen Medien unterwegs sind - so die Gegenhypothese - weniger neuronale Aktivität in den gleichen Hirnregionen aufweisen. Besonders interessierten sich die Forschenden deshalb für das Striatum in Bezug auf motivierende Regionen, die Inselrinde und die Amygdala für die affektive Salienz und den dorsolateralen präfrontalen Kortext (DLPFC) für die kognitive Kontrolle.
Methodik
Für die dreijährige, longitudinale Kohortenstudie rekrutierte das Team Sechst- und Siebtklässler aus drei Mittelschulen im ländlichen Nordkalifornien in den USA. In drei aufeinanderfolgenden Jahren untersuchten sie die Gehirne der Jugendlichen mittels funktionaler Magnetresonanztomographie (fMRT). Während der fMRT-Untersuchung sollten die Teilnehmenden ein Computerspiel (Social Incentive Delay Task) spielen, das in Kombination mit den fMRT-Aufnahmen ihre neuronale Antwort auf erwartete Belohnungen, Bestrafungen oder neutrale Stimuli testen sollte. Dafür wurde den Jugendlichen jeweils für 500 ms ein Hinweis gezeigt, ob sie gleich belohnendes, bestrafendes oder neutrales soziales Feedback erhalten werden. Anschließend wurde ihnen nach unterschiedlichen zeitlichen Abständen jeweils für 300 ms ein Target eingeblendet, auf das die Jugendlichen so schnell wie möglich mit einem Knopfdruck reagieren sollten. Schnelles Drücken, ein sogenannter Hit, wurde mit einem glücklichen Gesicht belohnt, wenn das soziale Feedback belohnend sein sollte. Drückten die Jugendlichen langsam, wurde ihnen ein verschwommenes Gesicht gezeigt. Bei sozialer Bestrafung wurde bei einem Hit ein verschwommenes Gesicht gezeigt, bei einem Miss (langsames Drücken) ein wütendes. Neutrales Feedback triggerte demnach immer ein verschwommenes Gesicht.
Im ersten Jahr wurde zusätzlich das Nutzungsverhalten der Jugendlichen in Bezug auf soziale Medien erhoben. Dazu sollten sie angeben, wie oft sie die Plattformen Facebook, Instagram und Snapchat am Tag besuchen. Insgesamt gab es neun verschiedene Kategorien mit <1x pro Tag bis hin zu >20x pro Tag. Anhand dieser Angaben wurden die Jugendlichen in gewohnheitsmäßig Nutzende, moderat Nutzende und nichtgewohnheitsmäßig Nutzende eingeteilt. Als gewohnheitsmäßig Nutzende galten die Jugendlichen, die mehr als 14x pro Tag auf den genannten Plattformen unterwegs waren. Waren sie zwischen 1x und 14x pro Tag in den sozialen Medien unterwegs, galten sie als moderat Nutzende. Jugendliche, die weniger als einmal am Tag ihre sozialen Medien aufriefen, galten als nichtgewohnheitsmäßig Nutzende.
Die fMRT-Aufnahmen wurden mittels 3dLMEr Programm (AFNI) ausgewertet und mittels 2- und 3-way Interaktionen analysiert.
Ergebnisse
Insgesamt wurden 178 Teilnehmende im Alter von 12 Jahren für die Studie rekrutiert. Eingeschlossen werden konnten 169. Das durchschnittliche Alter lag bei 12,89 Jahren (Standardabweichung 0,58; 11,93 bis 14,52). Etwas mehr als die Hälfte war weiblich (91; 53.8%). Von den Teilnehmenden waren 22,5% dunkelhäutig, 35,5% Latino, 29,6% weiß, 8,9% gemischt und 2,6% von anderem ethnischen Ursprung.
Von allen Jugendlichen entfielen 79 auf die Gruppe der nichtgewohnheitsmäßigen Nutzenden, 34 waren moderat Nutzende und 56 galten als gewohnheitsmäßig Nutzende.
Die Studie konnte zeigen: das Gehirn von Jugendlichen, die regelmäßig soziale Medien nutzen, entwickelt sich etwas anders als das von Jugendlichen, du nur wenig in sozialen Medien unterwegs sind.
Die Jugendlichen, die zu Beginn der Studie angaben, gewohnheitsmäßig Nutzende zu sein, hatten im Alter von 12 Jahren eine niedrigere neuronale Empfindlichkeit gegenüber sozialer Antizipation als andere Gleichaltrige. Das zeigte sich beispielsweise in der Amygdala, der hinteren Inselrinde, dem Striatum und dem dorsolateralen präfrontalen Kortex-Regionen, die mit affektiver Salienz und motivationaler und kognitiver Kontrolle verbunden sind (linke Amygdala/hinterer Inselkortex/Striatum β=−0.22; 95%-Konfidenzintervall (KI) −0.33 bis −0.11; rechte Amygdala β=−0.23; 95%-KI −0.37 bis −0.09; linker dorsolateraler präfrontaler Kortex β=−0.29; 95%-KI −0.44 bis −0.14). Im Verlauf der Studie stieg die neurale Empfindlichkeit in den gleichen Regionen signifikant an (p<0,05; linke Amygdala/hinterer Inselkortex/Striatum β=0,11; 95%-KI 0,04 bis 0,18; rechte Amygdala β=0,09; 95%-KI 0,02 bis 0,16; linker dorsolateraler präfrontaler Kortex β=0,19; 95%-KI 0,05 bis 0,25).Bei Jugendlichen, die pro Tag wenig in sozialen Medien unterwegs waren, war der Trend umgekehrt. Bei ihnen sank die Aktivität in den untersuchten Regionen im Laufe der drei Jahre.
Das lässt das Forschungsteam vermuten, dass habituelles Nutzungsverhalten von sozialen Medien bei Jugendlichen die Aktivität von Hirnregionen beeinflussen könnte. Während Amygdala, Inselkortex, Striatum und dorsolateraler präfrontaler Kortex bei gewohnheitsmäßig Nutzenden zu Beginn der Studie im Alter von 12 Jahren hypoaktiv waren, wurde im Verlauf in diesen Regionen ein Anstieg der Aktivität beobachtet. Bei nichtgewohnheitsmäßig Nutzenden hingegen sank die neuronale Aktivität in diesen Regionen. Das könnte möglicherweise ein Hinweis darauf sein, dass Jugendliche mit nichtgewohnheitsmäßigem Nutzverhalten besser in der Lage sind, impulsives oder habituelles Verhalten zu kontrollieren.
Fazit
Die Studie versucht zu demonstrieren, dass das Nutzungsverhalten von sozialen Medien bei Jugendlichen das Gehirn beeinflussen kann. Jugendliche, die täglich viel in den sozialen Medien unterwegs sind, zeigten eine veränderte Sensitivität in verschiedenen Hirnregionen bei erwarteter sozialer Belohnung und Bestrafung. Im Laufe der dreijährigen Studie stieg die Aktivität in Regionen, die für affektive Salienz und motivierende oder kognitive Kontrolle zuständig sind, bei diesen Jugendlichen an, während sie bei anderen Gleichaltrigen abfiel.
Ob es sich hierbei um eine Kausation oder um eine Korrelation handelt, lässt sich basierend auf den Studiendaten nicht eindeutig beurteilen. Die Studienautoren selbst schreiben, dass es schwierig sei, zu beurteilen, inwieweit Nutzung sozialer Medien dafür verantwortlich sei oder die Jugendlichen bereits vor der Studie eine Veranlagung für habituelles Nutzungsverhalten hatten.