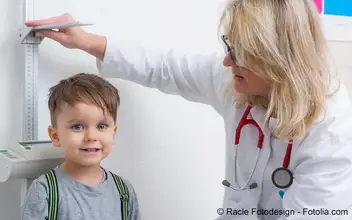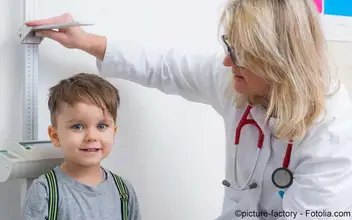Bei schulpflichtigen Kindern ist ein Kopflausbefall (Pediculosis capitis) ein weltweit verbreitetes Gesundheitsproblem. Der Parasit Pediculus capitis ist auf die Kopfhaut beschränkt und kann zu einem belastenden Pruritus der führen. Auch Depressionen, Schlaflosigkeit, Allergien und Haarausfall können durch den Befall ausgelöst werden. Obwohl pedikulizide Mittel Kopfläuse wirksam abtöten, ist die Wiederbefallsrate hoch.
Epidemiologische Studien haben gezeigt, dass lokale Prävalenzraten zwischen null und über 80% liegen. In verschiedenen Studien wurde die Pediculosis capitis-Prävalenz unter Kindern im Schulalter weltweit untersucht. Allerdings unterscheiden sich die Ergebnisse zum Teil erheblich voneinander.
Zielsetzung
Die vorliegende Meta-Analyse wurde durchgeführt, um Forschern und Entscheidungsträgern im Bereich der öffentlichen Gesundheit einen Überblick über die Gesamtprävalenz von Pediculosis capitis unter Schulkindern weltweit zu ermöglichen.
Es liegt bereits eine systematische Übersichtsarbeit vor, in der die Prävalenz von Pediculosis capitis und Einflussfaktoren bei Grundschülern im Iran untersucht wurden [1].
Methodik
Das Autorenteam aus Wissenschaftlern von verschiedenen iranischen Forschungseinrichtungen durchsuchte die Datenbanken MEDLINE/PubMed, Scopus und Web of Science ohne Sprachbeschränkung nach Veröffentlichungen zu Pediculosis capitis bei Schulkindern aus dem Zeitraum vom 1. Januar 1977 bis zum 1. Januar 2020. Alle begutachteten Originalforschungsartikel wurden eingeschlossen.
Die Ergebnisse wurden mit der Suchmaschine Google Scholar abgeglichen. Zudem kontaktierte das Team Forscher von Parasitenorganisationen per E-Mail, um weitere potenziell relevante Studien ausfindig zu machen, die bei der elektronischen Suche möglicherweise übersehen wurden. In einigen Fällen wurden Autoren direkt kontaktiert, um Rohdaten einsehen zu können.
Studienauswahl
Eingeschlossen wurden Studien, die Angaben zur Prävalenz von Pediculosis capitis bei Schulkindern machten.
Kriterien, um Studien auszuschließen, waren die folgenden:
- Studien mit P. capitis bei Erwachsenen;
- Studien, bei denen Haarproben vom Boden beim Friseur gesammelt wurden;
- Studien, in denen die Daten zu den einzelnen Teilnehmern nicht unabhängig abrufbar waren;
- Artikel, die nur das Endergebnis präsentierten und keine Rohdaten zu Kindern und Geschlecht lieferten;
- Studien ohne konkrete Stichprobengröße;
- Nicht-englischsprachige vollständige Arbeiten ohne englische Zusammenfassung;
- Experimentelle Studien:
- Fall-Kontroll-Studien;
- Klinische Studien, die keine genaue Aussage zur Prävalenz machten
Qualitätsprüfung
Um die Qualität der Studien zu beurteilen, wurden die Empfehlungen der „Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology“ (STROBE)-Initiative verwendet. Die Checkliste enthält Punkte, um die Studienmethodik, den Studientyp, die Stichprobengröße, die Methoden zur Probensammlung und die statistischen Tests zu bewerten. Die Autoren der vorliegenden Metaanalyse erklärten, dass alle von ihnen eingeschlossenen Studien eine akzeptable Qualität aufwiesen.
Meta-Analyse
Die für die Untersuchungen relevanten Daten wurden aus den Studienberichten extrahiert und mit statistischer Metaanalyse unter Verwendung von Stata 14 gepoolt (Stata Corporation, College Station, TX, USA). Es wurden die Prävalenzen und deren 95%-Konfidenzintervalle ermittelt. Die Heterogenität wurde mit dem Chi-Quadrat-Test und dem I2-Test bewertet. Zur statistischen Analyse wurde das Zufallseffektmodell von DerSimonian und Laird (1986) angewendet.
Subgruppenanalysen wurden für die unterschiedlichen Geschlechter und Kontinente vorgenommen. Um einen möglichen Publikationsbias zu bewerten, stellten die Autoren die Ergebnisse in einem Funnel-Plot dar und führten statistische Tests auf Funnel-Plot-Asymmetrie durch (Egger-Test). Es wurde eine Meta-Regression zur Bewertung der Effektstärken von Geschlecht und Studienjahr auf Prävalenzänderungen durchgeführt.
Ergebnisse
Die Autoren schlossen 201 Studien aus dem Zeitraum von 1977 bis 2020 in ihre Meta-Analyse ein. Damit gingen die Daten von 1.218.351 Schulkindern in die Untersuchung ein.
Es ergab sich insgesamt eine Pediculosis capitis-Prävalenz bei Schulkindern von 19%. Die Prävalenz lag bei Jungen (7%) deutlich niedriger als bei Mädchen (19%).
Die höchste Prävalenz ergab sich für Mittel- und Südamerika (33%), gefolgt von Afrika (31%), Australien (19%), Asien (18%) und Nordamerika (8%). Die niedrigste Prävalenz wurde in Europa beobachtet (5%). Hier wurde die höchste Prävalenz für die Tschechische Republik (14%) ermittelt und die niedrigsten Prävalenzen für Deutschland (2%), Polen (2%) und Norwegen (2%). Um die Veränderungen der Prävalenz über die Jahre zu bewerten, wurde eine Meta-Regression durchgeführt, die jedoch statistisch nicht signifikant war (p=0,304).
Die Egger-Regressionsgrafik zur Beurteilung des Publikationsbias zeigte, dass in allen Studien ein Publikationsbias bestand und in den meisten Studien eine geringe Präzision.
Haarlänge und -Hygiene
Die Beziehung zwischen Pediculosis capitis und Haarlänge wurde in 38 Studien untersucht. In 18 dieser Studien hieß es, dass langes Haar einen entscheidenden Einfluss auf den Kopflausbefall habe (p<0,05). Von 27 Studien, die den Zusammenhang zwischen Pediculosis capitis und der Häufigkeit des Haarewaschens untersuchten, zeigten zwölf Studien einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Haarwasch-Gewohnheiten und einer Verlausung (p<0,05).
Familiäres Umfeld
Es untersuchten 38 Studien den Effekt des Bildungsniveaus der Mutter, wobei 22 ein statistisch höheres Infektionsrisiko bei Kindern zeigten, deren Mütter ein niedriges Bildungsniveau hatten (p<0,05). Ein niedriges Bildungsniveau des Vaters ging in 24 von 37 Studien mit einer höheren Prävalenz von Pediculosis capitis einher (p<0,05).
Neun von 28 Studien zeigten einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit der Mutter und Pediculosis capitis (p<0,05) und 13 von 32 Studien zwischen der Erwerbstätigkeit des Vaters und Pediculosis capitis (p<0,05). Es untersuchten 35 Studien den Zusammenhang zwischen Prävalenz und Familiengröße, 21 davon zeigten ein höheres Infektionsrisiko bei Schulkindern, die in größeren Familien lebten (p<0,05).
Fazit
Die Autoren versuchten Daten, die über einen Zeitraum von 45 Jahren an unterschiedlichen geografischen Orten gesammelt wurden, in Beziehung zu setzen und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Dabei ist zu beachten, dass es in verschiedenen geografischen Gebieten, insbesondere in abgelegenen und unterentwickelten Regionen, enorme Veränderungen in der Sozialstruktur, der Demographie, der sozialen Stabilität, der Migration und der medizinischen Versorgung gegeben hat.
Die in die Meta-Analyse eingeschlossenen Daten lassen auf eine Prävalenz des Kopflausbefalls bei Schulkindern insgesamt von 19% schließen, wobei Mädchen mehr als 2,5-mal häufiger befallen waren als Jungen. Das sei laut den Autoren auf geschlechtsspezifische Verhaltensunterschiede wie den engeren körperlichen Kontakt unter Mädchen zurückzuführen. Die Haarlänge war ein weiterer Faktor, der mit dem Befall von Kopfläusen in Verbindung gebracht wurde.
Geschlechtspezifische Prävalenzen
Es berichteten 86 Arbeiten über geschlechtsspezifische Prävalenzen. Die Prävalenz bei Jungen reichte von 0% im Iran und Thailand bis zu 58,5% in Pakistan. Die Prävalenz bei Mädchen reichte von 0% in Thailand und Jordanien bis zu 93,2% in Pakistan.
Ein Vergleich der Ergebnisse verschiedener Studien in verschiedenen Ländern zeigte, dass die Gesamtprävalenz unabhängig vom Geschlecht unter pakistanischen Schulkindern höher war als in anderen Ländern.
Starker Einfluss soziökonomischer Bedingungen
Die angegebene Prävalenz in verschiedenen Nationen schwankte stark. Das zeigt, dass es zwar weltweit eine heterogene Befallsrate gibt, aber vor allem sozioökonomische Bedingungen einen Befall beeinflussen. Das Befallsrisiko ist erhöht für Kinder mit schlecht gebildeten Eltern, langen Haaren, großen Familien, arbeitslosen Müttern und Vätern und seltenerem Waschen.
Forderung nach lokalen Maßnahmen
Die Prävalenz von Pediculosis capitis sinkt mit steigendem Lebensstandard, Familieneinkommen und besseren Rahmenbedingungen für die medizinische Versorgung. Doch auch in entwickelten Ländern werden Menschen immer noch von Läusen befallen. In den meisten europäischen Ländern oder auch in Nordamerika und Australien gibt es zwar klare Leitlinien zur Erkennung, Diagnose, Behandlung und Vorbeugung eines Befalls, diese Maßnahmen bezeichnen die Autoren allerdings als erfolgslos. Sie fordern, Screening- und Prophylaxe-Maßnahmen auf den lokalen Kontext zuzuschneiden. Als zentralen Punkt, um einen erneuten Befall zu verhindern, identifizierten die Autoren geeignete Hygienepraktiken.
Limitationen
Als Limitation ihrer Analyse wiesen die Autoren darauf hin, dass ihre Ergebnisse den Befall mit Pediculus capitis auf der ganzen Welt nicht umfassend beschreiben würden. Zukünftige Studien könnten aber darauf aufbauen.
Das Protokoll der vorliegenden systematischen Überprüfung wurde im International Prospective Register of Systematic Reviews (PROSPERO) registriert, Studienprotokollregistrierung CRD42018103342.