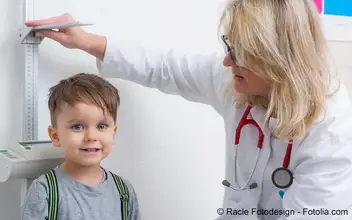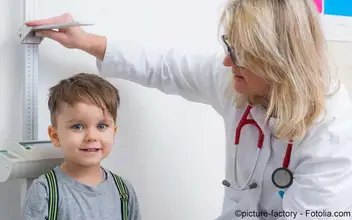Werbung beeinflusst unsere täglichen Entscheidungen. Das trifft zwar auf alle Menschen zu, Kinder sind jedoch häufig noch deutlich beeinflussbarer als Erwachsene. Deshalb wird seit dem Regierungswechsel im vergangenen Herbst wieder vermehrt über Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel diskutiert. Zuletzt beispielsweise über ein Teilwerbeverbot für bestimmte Tageszeiten und Orte. Das ist jedoch nicht unumstritten, denn die Erfolge davon könnten mäßig sein.
Auswirkungen von Werbung auf Kinder und Jugendliche
Wie notwendig es ist, Kinder und Jugendliche zu schützen, zeigen die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte: Die Zahl der adipösen Kinder und Jugendlichen ist substanziell gewachsen. Das hat Folgen für die Gesundheit, die bis weit ins Erwachsenenalter hineinreichen.
Gesundheit
Inwieweit Werbung für ungesunde Lebensmittel wie Junk Food dabei eine Rolle spielt, ist umstritten. Die Assoziation zwischen dem Marketing für Nahrungsmittel und/oder nichtalkoholische Getränke, die viel Fett, Zucker und/oder Salz enthalten, und dem Verhalten von sowie den Gesundheitseffekten auf Kinder und Jugendliche ist sehr komplex. Sie erfüllt aber trotzdem Kriterien für einen kausalen Zusammenhang.
Kinderrechte
Das ist problematisch, denn sogenanntes Food Marketing kann sich die Kinderrechte einschränken. Dazu zählen unter anderem das Recht auf den höchstmöglichen Gesundheitsstandard, das Recht auf eine gute und gesunde Ernährung und das Recht auf Privatsphäre. Deshalb gibt es schon länger Ansätze von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), strengere Empfehlungen zum Marketing von Lebensmitteln und nichtalkoholischen Getränken, die Kinder und Jugendliche beeinflussen könnten, durchzusetzen. Aber bereits die Implementierung der bestehenden Empfehlungen ist inkonsistent. Eine neue Studie eines britischen Forscherinnenteams um Dr. Emma Boyland von der University of Liverpool hat sich nun nochmal im Auftrag der WHO in einem systematischen Review und einer Metaanalyse mit dem Thema befasst. Die Daten wurden im Journal »JAMA Pediatrics« veröffentlicht.
Zielsetzung
Für ein Update der Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation sollte die Assoziation zwischen dem Marketing von Lebensmitteln und nichtalkoholischen Getränken und dem Verhalten und Gesundheitsoutcome von Kindern und Jugendlichen quantifiziert werden.
Methodik
Für die Metaanalyse und das systematische Review wurden 22 Datenbanken, inklusive MEDLINE, CINAHL, Web of Science, Embace und The Cochrane Library analysiert. Eingeschlossen werden konnten Studien, die zwischen Januar 2009 und März 2020 publiziert wurden und die Assoziation von Food Marketing und spezifischen Outcomes bei Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 19 Jahren untersuchten. Ausgeschlossen wurden qualitative Studien und solche, die Werbung von Säuglingsnahrung untersuchten.
Alle Daten wurden hinsichtlich kritischer Outcomes erneut mittels Metaanalyse statistisch ausgewertet. Als kritische Outcomes wurden gewählt: Nahrungsaufnahme, Essenwahl, Vorlieben und Einkäufe, Kaufanfragen der Kinder und Jugendlichen, Zahnkaries, Körpergewicht, Body-Mass-Index (BMI), Adipositas und ernährungsassoziierte nicht-übertragbare Erkrankungen.
Ergebnisse
Insgesamt fand das Studienteam 31.063 potenziell interessante Studien, von denen 96 systematische Reviews und 80 Metaanalysen waren, die die Einschlusskriterien erfüllten. Aus den 80 Studien ergaben sich Daten zu 19.372 Teilnehmenden, die erneut analysiert werden konnten.
Food Marketing war klar assoziiert mit einer erhöhten Nahrungsaufnahme bestimmter Lebensmittel durch die Kinder und Jugendlichen (standardisierter durchschnittlicher Unterschied [SMD]=0,25; 95%-Konfidenzintervall [KI] 0,15 bis 0,35; p<0,001). Das Alter der Kinder (durchschnittlich 8,6 Jahre (4,1-13,6)) hatte darauf keinen signifikanten Einfluss (beta=-0,02; 95%-KI -0,071 bis 0,252; p=0,35).
Auch die Essenswahl war signifikant mit dem jeweiligen Food Marketing assoziiert (Odds Ratio=1,77; 95%-KI 1,26 bis 2,50; p<0,001). Unabhängig davon, ob die Testobjekte gesund oder ungesund waren, wählten die an den Studien teilnehmenden Kinder diese 1,77-mal häufiger. Auch hier war das Alter nicht signifikant (p=0,35). Ähnlich verhielt es sich mit den Vorlieben: Hier lag der standardisierte durchschnittliche Unterschied bei 0,30 (95%-KI 0,12 bis 0,49, p=0,001).
Auf andere Faktoren hatte das Food Marketing nur bedingt Einfluss. Zwar war es auch signifikant mit den Kaufanfragen der Kinder und Jugendlichen assoziiert, die Studiendichte war hier jedoch sehr gering. Ob Food Marketing dazu führt, dass Kinder und Jugendliche eher bestimmte Lebensmittel kaufen oder kaufen lassen, lässt sich evidenzbasiert, so die Studie, jedoch nicht sagen. Das gilt ebenso für die Assoziation zwischen Food Marketing und Zahnkaries, dem Körpergewicht oder dem BMI. Dafür ist die Datenlage zu dünn und die Ergebnisse sind zu heterogen.
Fazit
Food Marketing scheint einen Effekt auf das Essverhalten von Kindern und Jugendlichen zu haben. Das zeigen das systemische Review und die Metaanalyse des britischen Forscherteams. Die Vermarktung von Essen und nichtalkoholischen Getränken ist signifikant assoziiert mit einem erhöhten Konsum, einer Vorliebe und der Auswahl von Lebensmitteln durch Kinder und Jugendliche.
Fachgesellschaften fordern Werbebeschränkungen
Deshalb braucht es, so fordert es auch die Deutsche Diabetes Gesellschaft, klare Regeln für an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt. Teilverbote würden zu kurz greifen, erklärte im Februar 2022 erneut ein Bündnis aus Verbraucherschützenden, wissenschaftlichen Fachgesellschaften und Gesundheitsorganisationen.
„Kinder sind tagtäglich den Lockrufen für ungesunde Lebensmittel ausgesetzt. Das begünstigt ungesunde Ernährungsmuster im Kindesalter und kann sich ein Leben lang negativ auf die Gesundheit auswirken“, erklärt Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. „Im Sinne der Prävention ist es zielführend, die Werbung einzuschränken. Gerne unterstützen wir dieses Vorhaben mit konkreten Vorschlägen zum Wohle unserer Versicherten“, so Reimann.
Gesundheit der Kinder schützen
Vorschläge hierzu gibt es bereits einige, wie beispielsweise einen Wegfall der Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse und gleichzeitig höhere Besteuerungen von überzuckerten Getränken. Deshalb fordert die Deutsche Diabetes Gesellschaft der im Koalitionsvertrag angekündigten Änderungen müssten nun auch Taten folgen, um die zunehmenden Zahlen von Betroffenen mit Diabetes mellitus Typ 2 in Deutschland in den Griff zu bekommen und Kinder und Jugendliche langfristig vor negativen Effekten auf die Gesundheit zu schützen.