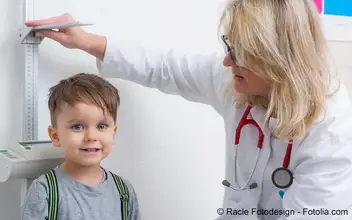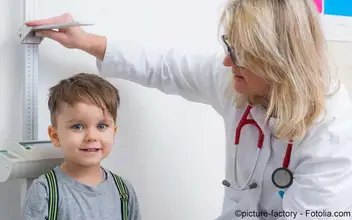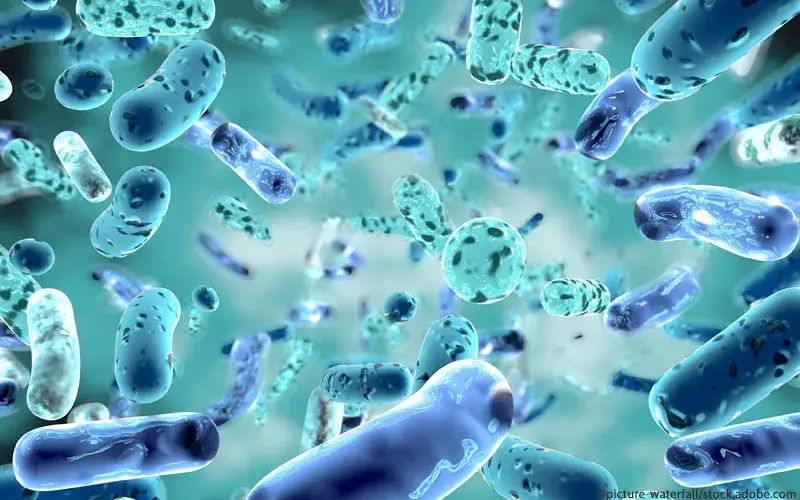
Die Antibiotika-assoziierte Diarrhö (AAD) ist eine häufige Komplikation der Antibiotikabehandlung. Sie entsteht, wenn die antibiotische Therapie die Mikrobiota im Darm verändert. Krankheitserreger, vor allem Clostridioides difficile, können sich dann übermäßig vermehren.
Definition AAD
Es gibt verschiedene Definitionen für die AAD, darunter „Durchfall, der im Zusammenhang mit der Behandlung mit Antibiotika auftritt und für den sich keine andere Ursache finden lässt“. Sowohl in der klinischen Praxis als auch in den meisten klinischen Studien werden allerdings routinemäßig keine mikrobiologischen Tests durchgeführt, um infektiöse Ursachen auszuschließen.
Die häufigste Intervention bei einer AAD sind Probiotika. Sie sind definiert als „lebende Mikroorganismen, die in geeigneten Mengen verabreicht dem Wirt einen gesundheitlichen Vorteil verleihen sollen“.
Studienergebnisse variieren
Laut einem Cochrane Review aus 2019 schützen Probiotika mäßig vor einer pädiatrischen AAD. Die Ergebnisse der einzelnen Studien variierten je nach Dosis der Probiotika. In Studien mit höheren Dosen von 5 Milliarden koloniebildenden Einheiten (CFU) oder mehr pro Tag zeigten sich bessere Wirkungen.
Zielsetzung
In der aktuellen Studie (NCT03334604) sollte die präventive Wirkung einer probiotischen Multispezies-Mischung mit acht Spezies im Hinblick auf AAD in einer pädiatrischen Population untersucht werden.
Methodik
Wissenschaftler aus Polen und den Niederlanden um Jan Łukasik von der Medical University of Warsaw führten eine randomisierte, vierfach-verblindete, Placebo-kontrollierte Studie im Zeitraum von Februar 2018 bis Mai 2021 in einem multizentrischen, gemischten Setting (stationär und ambulant) durch.
In die Studien wurden Kinder im Alter von drei Monaten bis 18 Jahren eingeschlossen. Die Rekrutierung musste innerhalb von 24 Stunden nach Einleitung einer systemischer Breitbandantibiotika-Therapie erfolgen. Insgesamt konnten die Forscher 350 Patienten einschließen.
Vierfach verblindet
Die Kinder wurden in Viererblöcken mit einem computerbasierten Zufallssequenzgenerator blockrandomisiert. Die Teilnehmer, Betreuer und alle Prüfärzte sowie Datensammler und Ergebnisbewerter waren bis zur Primärdatenanalyse verblindet. Probiotikum und Placebo waren identisch verpackt und hatten das gleiche Aussehen, den gleichen Geschmack und den gleichen Geruch.
Prüfpräparat
Die Eltern der Studienkinder wurden angewiesen, täglich zwei Beutel des ausgegebenen Prüfpräparats an ihre Kinder für die Dauer der Antibiotikatherapie und noch für sieben Tage danach zu verabreichen. Damit erhielten die Kinder eine Gesamtdosis von 10 Milliarden koloniebildenden Einheiten täglich. Die maximale Gabe des Prüfpräparats betrug 17 Tage. Die erste Gabe musste innerhalb von 24 Stunden nach der ersten Antibiotikadosis erfolgen.
Die Patienten in der Verum-Gruppe erhielten ein Multispezies-Probiotikum mit folgenden acht Bakterienstämmen:
- Bifidobacterium bifidum W23
- Bifidobacterium lactis W51
- Lactobacillus acidophilus W37
- Lacidophilus W55
- Lactocaseibacillus paracasei W20
- Lactoplantibacillus plantarum W62
- Lactocaseibacillus rhamnosus W71
- Ligilactobacillus salivarius W24
Stuhlanalysen
Während der Antibiotikabehandlung und für weitere sieben Tage wurden Studientagebücher geführt. Trat Durchfall auf, wurden Stuhlproben auf Rotavirus, Adenovirus, Norovirus, Campylobacter-Arten, Salmonella-Arten, Shigella-Arten, Yersinia-Arten und C. difficile untersucht.
Primärer Endpunkt AAD
Primärer Endpunkt der Studie war die AAD, definiert als drei oder mehr weiche oder wässrige Stühle pro Tag in einem Zeitraum von 24 Stunden. Die AAD musste entweder durch C. difficile verursacht oder ungeklärter Ätiologie sein.
Sekundäre Endpunkte
Die sekundären Endpunkte umfassten Durchfall unabhängig von der Ätiologie, leichte AAD, definiert als zwei oder mehr lockere oder wässrige Stühle pro Tag für mindestens 24 Stunden, schwere AAD, definiert als drei oder mehr weiche oder wässrige Stühle pro Tag für mindestens 48 Stunden, Dauer des Durchfalls, C. difficile-Diarrhö, definierte Durchfallkomplikationen und Nebenwirkungen.
Ergebnisse
Für die Studie wurden 350 Kinder (192 Jungen und 158 Mädchen, Durchschnittsalter 50 Monate) randomisiert und 313 wurden in die Intention-to-treat-Analyse eingeschlossen. Das Probiotikum hatte verglichen mit Placebo keinen signifikanten Einfluss auf das AAD-Risiko (23 von 158 [14,6%] in der Probiotikum-Gruppe gegenüber 28 von 155 [18,1%] in der Placebo-Gruppe). Kinder in der Verum-Gruppe hatten jedoch ein geringeres Durchfallrisiko unabhängig von der Ätiologie (33 von 158 [20,9%] vs. 50 von 155 [32,3%]).
Auswertung von Stuhltests
Unter den 83 Durchfall-Patienten ergab bei zehn Kindern ein Stuhltest einen positiven Nachweis auf Rotavirus, bei drei auf Norovirus, bei einem auf Adenovirus und bei einem auf Salmonella enterica. Sechs Patienten in der Probiotikum-Gruppe und elf Patienten in der Placebo-Gruppe stellten keine Stuhlproben zur Verfügung. Diese Kinder wurden nicht als AAD-Fälle für den primären Endpunkt berücksichtigt.
Sekundäre Endpunkte
Bezogen auf die meisten sekundären Endpunkte einschließlich von unerwünschten Wirkungen wurden keine Unterschiede zwischen den Gruppen beobachtet. Die Kinder in der Probiotikum-Gruppe mussten jedoch seltener aufgrund von Durchfall intravenös rehydriert werden (0 von 158 [0%] vs. 5 von 155 [3,2%]
Fazit
Das Multispezies-Probiotikum hatte keine signifikante präventive Wirkung auf das Risiko einer AAD definiert als drei oder mehr weiche/wässrige Stühle pro Tag, ausgelöst durch C. difficile oder unbekannter Ätiologie. Das Probiotikum senkte allerdings das Gesamtrisiko für Durchfall unabhängig von der Ätiologie von 32% auf 21%.
Ausschluss anderer Ursachen
Mit der strengen Definition von AAD in der aktuellen Studie wollten die Wissenschaftler zwischen klinisch relevanten Konsistenzveränderungen und klinisch unbedeutenden Veränderungen des Stuhls unterscheiden. Sie wollten weiterhin Infektionen etwa mit dem Norovirus oder Rotavirus oder eine Gastroenteritis ausschließen, da diese nicht in direktem Zusammenhang mit einer Antibiotika-Behandlung stehen.
Relevanz von Ätiologie-Tests
Die Definition von AAD variierte in früheren Studien und häufig wurden auch keine mikrobiologischen Tests durchgeführt. Das lässt die Frage offen, ob in diesen Studien tatsächlich Fälle von AAD oder eher Durchfall während einer Antibiotikabehandlung unabhängig von der Ätiologie betrachtet wurde. Ätiologie-Tests werden in der Praxis für akute Fälle nicht routinemäßig empfohlen. Sowohl für Patienten als auch für den Arzt ist es in der Regel nicht relevant, was den Durchfall verursacht, solange eine präventive Intervention wirksam ist.
Limitationen der Studie
Bei der Studie handelt es sich dem Forscherteam zufolge um die bislang größte Studie, die die Wirkung eines Probiotikums mit mehr als drei Arten von Mikroorganismen bezüglich AAD bei Kindern untersucht. Zu den Einschränkungen gehört jedoch, dass der Anteil der Patienten, der nicht nachverfolgt werden konnte, relativ hoch ist. Die Wissenschaftler schließen allerdings aus, dass die fehlenden Daten zu einer signifikanten Verzerrung der Studie führten.
Eine weitere Limitation ist die mögliche Fehlklassifizierung von Durchfall als AAD. Das ist der diagnostisch begrenzten Genauigkeit von Immunoassay-Tests geschuldet sowie der begrenzten Anzahl von getesteten Durchfallerregern und der Anzahl der Patienten, die keine Stuhlproben abgegeben haben. Diarrhöe-Fälle, die später als eine Woche nach Absetzen der Antibiotika auftraten, wurden durch die Studie nicht erfasst.