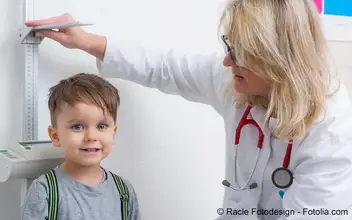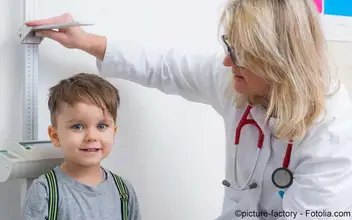Etwa eins von 100 Kindern und fünf von 100 Jugendlichen leiden an einer depressiven Störung. Wie bei Erwachsenen treten Symptome wie gedrückte Stimmung, fehlender Antrieb, geringes Selbstwertgefühl oder auch Interessenverlust und Freudlosigkeit auf. Je nach Alter und Symptomatik kann die frühzeitige Erkennung einer Depression jedoch erschwert sein. Begleiterkrankungen wie Angst- oder Essstörungen sowie eine Fehlinterpretation typisch jugendlich-pubertären Verhaltens können die Diagnosekriterien überlagern oder verzerren. Zwar erholen sich etwa 90% der betroffenen Kinder und Jugendlichen nach ein bis zwei Jahren von der Depression, mindestens die Hälfte von ihnen erleidet jedoch innerhalb von fünf Jahren einen Rückfall. Erste Anzeichen einer Depression sollten daher frühzeitig abgeklärt und bei entsprechender Diagnose therapiert werden.
Therapie depressiver Störungen in der Pädiatrie
Zu den Standardbehandlungen depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen zählen die Psychotherapie sowie die Therapie mit Antidepressiva. Die Art der Behandlung hängt vom Schwergrad der Depression ab. Leichte Formen werden zunächst nicht behandelt. In Leitlinien wird eine Psychotherapie vor allem bei mittelschweren oder schweren Depressionen empfohlen. Antidepressiva sollen aufgrund möglicher Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen zurückhaltend angewendet werden.
Psychotherapieformen im Vergleich
In einem HTA-Bericht des IQWiG wurde die Wirksamkeit psychotherapeutischer Maßnahmen bei Kindern und Jugendlichen mit depressiven Störungen untersucht und mit weiteren Therapieoptionen verglichen. Dabei wurden die psychotherapeutischen Maßnahmen in kognitive Verhaltenstherapie, interpersonelle Psychotherapie und psychodynamische Psychotherapie unterschieden.
Formen der Psychotherapie
Während Betroffene bei einer kognitiven Verhaltenstherapie lernen, belastende Denkmuster zu erkennen und zu verändern, liegt der Schwerpunkt der interpersonellen Psychotherapie auf zwischenmenschlichen Belastungen und Konflikten. Im Rahmen einer psychodynamischen Psychotherapie werden verstärkt Auslöser für die Beschwerden verarbeitet.
Methodik des HTA-Berichts
Eine Expertengruppe der Donau-Universität Krems untersuchte 13 systematische Übersichtsarbeiten mit Daten aus 150 Primärstudien. Darin waren Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 18 Jahren eingeschlossen.
Verglichen wurden die genannten psychotherapeutischen Behandlungsformen mit inaktiven Kontrollen (Warteliste, psychologisches Placebo), einer Antidepressiva-Therapie allein oder der Kombination mit einer solchen. Es sollten die Auswirkungen einer Psychotherapie auf patientenrelevante Endpunkte wie Veränderungen depressiver Symptome, das Suizidrisiko und die gesundheitsbezogene Lebensqualität untersucht werden. Systemische Therapien wurden von der Untersuchung ausgeschlossen.
Ergebnisse
Sowohl die Daten zu kognitive Verhaltenstherapie als auch interpersonelle Psychotherapie zeigten eine Linderung depressiver Symptome bei Kindern und Jugendlichen. Zudem gab es für die interpersonelle Psychotherapie einen Hinweis, dass diese eine Bewältigung von Familie, Schule und soziale Aktivitäten erleichtert.
Der Vergleich mit der alleinigen Verordnung von Antidepressiva zeigte für kognitive Verhaltens- sowie interpersonelle Psychotherapie keine Hinweise auf eine bessere oder schlechtere Wirksamkeit. Studien zur kognitiven Verhaltenstherapie deuten darauf hin, dass diese als Add-on-Therapie zur Einnahme von Antidepressiva vorteilhaft sein kann. Studien zu interpersoneller Psychotherapie in Kombination mit Antidepressiva konnten nicht gefunden werden.
Die Datenlage zu psychodynamischer Psychotherapie war insgesamt sehr gering. Es wurden Netzwerkmetaanalysen betrachtet, die auch Studien einschlossen, bei denen weniger als 80% der Teilnehmenden die Einschlusskriterien des HTA-Berichts erfüllten. Die wenigen Studien zeigten keine Hinweise zu einer Linderung depressiver Symptome bei Kindern und Jugendlichen.
Offene Fragen
Ergebnisse zur Gesamt- und Suizidmortalität oder zur gesundheitsbezogenen Lebensqualität wurden in den systematischen Übersichtsarbeiten ebenso wenig betrachtet, wie unerwünschte Ereignisse. Eine vollständige Nutzen-Schaden-Abwägung ist daher nicht möglich.
Zum Vergleich der drei Psychotherapie-Formen mit nicht medikamentösen Verfahren wie Sport oder Entspannungsübungen, die als alleiniger Therapieansatz meist nur bei leichten Depressionen empfohlen werden, wurden keine Studien gefunden. Auch die Frage, wie gut die untersuchten Psychotherapien bei verschiedenen Schweregraden der Depression oder in den unterschiedlichen Altersgruppen wirken, konnte aufgrund mangelnder Daten nicht beantwortet werden.
Fazit
Die Diagnose einer depressiven Störung im Kindes- und Jugendalter kann durch Komorbiditäten und Verhaltensstörungen erschwert sein. Erste Anzeichen einer Depression sollten frühzeitig abgeklärt werden. Niedrigschwellige Angebote sowie ausreichend Therapieplätze für Betroffene seien dafür essenziell, so die Wissenschaftler.
Der HTA-Bericht zeigt, dass kognitive Verhaltenstherapie und die interpersonelle Psychotherapie depressive Symptome bei Kindern und Jugendlichen lindern können. Ergebnisse qualitativer Forschung deuten darauf hin, dass eine Psychotherapie weitgehend als kausale Behandlungsmethode akzeptiert wird. Antidepressiva hingegen würden eher als symptomatische Therapie mit potenziellen Risiken angesehen, so die Expertengruppe.
Derzeit fehlen Studien darüber, wie wirksam die Psychotherapieformen bei unterschiedlichen Schweregraden einer Depression sind. Daher seien aussagekräftige Untersuchungen insbesondere in Bezug auf psychodynamische Psychotherapie und bei Vorschulkindern im deutschen Versorgungskontext notwendig. Diese sollten gesundheitsbezogene Lebensqualität, unerwünschte Ereignisse sowie das Alter betrachten. Zudem sind langfriste Nachbeobachtungen nötig, um das Rezidivrisiko besser abschätzen zu können.