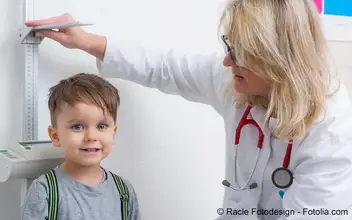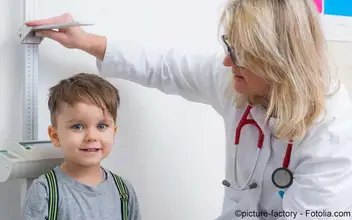Das Legen eines peripheren Venenkatheters gehört zu den häufigsten besonders stressigen Prozeduren für Patienten im Kindesalter. Außerdem erschwert eine fehlende Kooperation der Kinder diesen Vorgang und häufige frustrane Versuche können bei den Patienten wiederum Nadelphobien und psychische Traumata auslösen.
Lokalanästhetika und systemische Analgetika wirken nur mäßig schmerzlindernd und können die Furcht vor dem Kanülenstich nicht mindern. In der pädiatrischen Praxis werden die Patienten häufig abgelenkt, um die Angst und den Stress zu verringern. Auch die Immersion in eine virtuelle Realität (virtual reality, VR) kann zur Ablenkung genutzt werden. VR-gestützte Ablenkung konnte schon bei anderen schmerzhaften Prozeduren wie der Brandwundenversorgung erfolgreich eingesetzt werden.
Zielsetzung und Finanzierung
In einer neuen randomisierten kontrollierten Studie publiziert in »JAMA Pediatrics« wurde eine VR-gestützte Ablenkung mit fehlender VR-gestützter Ablenkung bei dem Legen eines peripheren Venenkatheters bei Kindern verglichen.
Die Studie wurde durch die National Research Foundation of Korea finanziert.
Methodik
Insgesamt 88 Patienten im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren, denen zur Diagnostik oder Therapie ein peripherer Venenkatheter in der pädiatrischen Notaufnahme gelegt werden musste, wurden 1:1 in zwei Gruppen randomisiert. Patienten wurden u. a. von der Studie ausgeschlossen, wenn sie notfallmäßig einen intravenösen Zugang erhalten mussten oder wenn es bei ihnen z. B. aufgrund einer Gesichtsanomalie schwerer war, die Schwere der Schmerzen einzuschätzen.
Für die Patienten in der Interventionsgruppe wurden kindgerechte VR-Animationen an einem Deckenbildschirm in Form einer Kuppel gezeigt. Die Animationen waren drei Minuten lang und simulierten, dass das zuschauende Kind zusammen mit vier befreundeten Tiercharakteren durch einen Wald rennt. Nach ca. einer Minute wurde der periphere Venenkatheter gelegt. In der Kontrollgruppe wurden die Patienten ebenfalls gebeten, sich hinzulegen und anschließend katheterisiert, jedoch wurden ihnen keine VR-Animationen gezeigt.
Als primäres Outcome wurde eine Beurteilung durch zwei Ärzte auf Basis des Face-Legs-Activity-Cry-and-Consolability-(FLACC)-Scores gewählt. Die Beurteilungen wurden zu vier Zeitpunkten vorgenommen: Sofort nachdem sich das Kind hingelegt hat, als das Tourniquet angebracht wurde, als der Alkoholtupfer zur Desinfektion genutzt wurde und während des Einstichs der Nadel. Als Ausgangswert wurde die Beurteilung bei Betreten des Behandlungsraumes gewählt.
Nach der Prozedur wurden die Betreuungspersonen der Patienten nach der Zufriedenheit mit dem Vorgang und den Schmerzen und Ängsten der Kinder gefragt. Diese Einschätzungen wurden als sekundäre Outcomes genutzt.
Ergebnisse
Die Charakteristika der Patienten und ihrer Betreuungspersonen waren zwischen der Kontroll- und Interventionsgruppe sehr ähnlich verteilt. Davon abgesehen haben 6,8% der Kinder in der Kontrollgruppe und keines der Kinder in der Interventionsgruppe bereits Analgetika in den letzten beiden Stunden vor der Prozedur genommen. Auch waren Kinder in der Kontrollgruppe häufiger fiebrig (18,2% vs. 6,8%).
Die FLACC-Scores erhöhten sich leicht in beiden Gruppen im Verlauf der Prozedur, jedoch war der Schmerz-Score zu allen Zeitpunkten in der Interventionsgruppe niedriger als in der Kontrollgruppe. Beim Einstich der Nadel betrug der FLACC-Score in der Interventionsgruppe im Median 6,0 (Interquartilsabstand [IQR]: 1,8 bis 7,5) und in der Kontrollgruppe im Median 7,0 (IQR: 5,5 bis 7,8). Eine Analyse auf ordinaler logistischer Regression basierend zeigte, dass die Interventionsgruppe eine signifikant geringere Wahrscheinlichkeit besaß, einen höheren FLACC-Score zu haben als die Kontrollgruppe (Odds Ratio: 0,53; 95%-Konfidenzintervall [KI]: 0,28 bis 0,99; p=0,046).
Die Auswertungen zeigten weiterhin, dass sowohl der Zeitpunkt der Beurteilung als auch die An- bzw. Abwesenheit der Intervention einen signifikanten Effekt auf den FLACC-Score hatten.
Bei der Subgruppenanalyse nach Geschlecht zeigte sich, dass die Schmerzen der Mädchen zum Zeitpunkt direkt nach dem Hinlegen vor der eigentlichen Katheterisierung in der Interventionsgruppe deutlich niedriger war (Median 0,0; IQR: 0,0 bis 4,0) als in der Kontrollgruppe (Median 7,2; IQR: 5,0 bis 7,9). Dieser Effekt war auch nach einer Bonferroni-Korrektur noch stark signifikant. Bei den Jungen wurde kein Unterschied beobachtet. Bei der Subgruppenanalyse nach dem Alter wurden keine signifikanten Effekte festgestellt.
Laut den Antworten der Betreuungspersonen schätzten diese den Schmerz (Median: 5,0 vs. 7,0; p=0,008) und die Angst (Median: 5,0 vs. 8,0; p<0,001) bei der Prozedur in der Interventionsgruppe signifikant niedriger ein als in der Kontrollgruppe. Bei der Zufriedenheit der Betreuungspersonen mit dem Vorgang gab es jedoch keinen Unterschied (beide Gruppen im Median 4,0 und IQR 3,0 bis 4,0).
Fazit
Die Ergebnisse dieser randomisierten kontrollierten Studie suggerieren, dass das Nutzen von VR-Umgebungen eine effektive Ablenkungsmethode bei dem Legen von peripheren Venenkathetern bei Kindern sein kann. Dies wird besonders untermauert durch das Ergebnis, dass der FLACC-Score bei Kindern in der Interventionsgruppe zu allen Beurteilungszeitpunkten niedriger war als in der Kontrollgruppe. Dabei scheint diese Ablenkungsmethode besonders für Mädchen geeignet zu sein, die mit der VR-Ablenkung deutlich weniger Schmerzen vor der eigentlichen Katheterisierung haben als ohne VR-Ablenkung.
Limitationen
Leider war es dem Studiendesign geschuldet, dass es nicht möglich war, die beurteilenden Studienärzte oder die Betreuungspersonen zu verblinden, sodass die Studienergebnisse möglicherweise verzerrt sein können. Außerdem könnte es für das katheterisierende Personal schwieriger gewesen sein, in der Interventionsgruppe Venen zur Punktion zu finden, da in dieser Gruppe das Raumlicht aus war und zur Venensuche eine Taschenlampe genutzt werden musste.