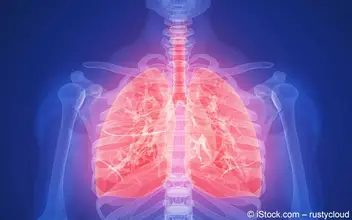Es ist kein Wunder, dass „Deep Learning“ und künstliche Intelligenz (KI) gerade in der Radiologie so eine große Rolle spielen – sind doch Daten aus der Bildgebung in digitaler Form für die Verarbeitung mit Computeralgorithmen verfügbar, erklärte Dr. Annemiek Snoeckx, Radiologin von der Universität von Antwerpen in Belgien [1]. Es ist aber keineswegs selbstverständlich, dass die Beurteilung von Lungenrundherden mit KI besser gelingt als dem Radiologen alleine. Im diagnostischen Röntgenthorax „übersah“ Kollege Computer in verschiedenen Studien bis zu einem Viertel der für das geschulte Auge sichtbaren Lungenkarzinome, berichtete sie anlässlich des ERS-Kongresses 2021. Es deutete sich aber in dieser Situation schon an, dass Radiologe und KI zusammen bessere Ergebnisse erzielen können als beide alleine.
Herausforderungen beim Lungen-CT
In der NLST-Screeningstudie erkannten Radiologen in der Computertomographie (CT) der Lunge bis zu 9% der Karzinome auf dem initialen CT nicht. Ursachen waren menschliches Versagen, Zeitdruck oder Erschöpfung [2]. Die gleichzeitige Auswertung durch zwei Radiologen verbessert die korrekte Erkennung, ist aber zeit- und kostenintensiv. Deshalb kommt die KI ins Spiel. Vorteile der KI liegen in der möglicherweise genaueren Abschätzung der Größe der Rundherde durch eine volumetrische dreidimensionale Auswertung, die durch Deep-Learning-Algorithmen sukzessive immer weiter verbessert werden kann. Über Größe und Wachstumsgeschwindigkeit hinaus kann die automatisierte Auswertung der digitalen CT-Daten auch Formen, Muster oder Texturen besser einschätzen helfen. Zudem gibt es nur radiologisch feststellbare Eigenschaften, „Radiomics“, die zukünftig eine zusätzliche Einordnung von Herden erlauben könnten – ein Feld für weitere Forschungsprojekte, betonte Snoeckx.
KI ist genauso gut wie Radiologen – und jetzt?
Mittlerweile sind Deep-Learnings-Algorithmen so weit entwickelt, dass sie ebenso gut wie Radiologen Lungen-Rundherde in der Niedrig-Dosis-Computertomographie (LDCT für engl. Low-dose CT) erkennen können, wie eine retrospektive Auswertung der externen Validierung dreier Kohorten einer dänischen Lungenkrebsscreening-Studie zeigt [3]. Das wirft die Frage auf, wo im Arbeitsablauf die KI ihren Platz findet. Aktuell verfügbare kommerzielle Systeme setzten die KI nach der Auswertung durch den radiologischen Profi ein oder auch gleichzeitig: Der Radiologe hat parallel zu seiner Auswertung die Ergebnisse der KI zur Verfügung, um die Befunde gemeinsam zu interpretieren. Denkbar wäre aber auch, dass die KI zuerst eingesetzt wird und Fachpersonal nur die dort auffälligen Befunde analysiert oder längerfristig nur die KI die Auswertung übernimmt.
Evidenz noch schwach
Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Eine aktuelle Analyse radiologischer KI-Systeme allgemein zeigte, dass bei 64 von 100 Produkten keinerlei Evidenz aus Peer-Review-Zeitschriften vorliegt [4]. Für zwei Drittel der übrigen Systeme bezogen sich die begutachteten, publizierten Ergebnisse nur auf die diagnostische Genauigkeit (Evidenzlevel 2) und nur 18 konnte auch mit Evidenzlevel 3 aufwarten, d.h. hatten den möglichen Einfluss des Einsatzes des Systems auf das diagnostische Denken, Patienten-bezogene Ereignisse oder Kosten hin untersucht.
Ausblick
Die KI-Algorithmen werden sich weiter entwickeln, aber die Validierung in großen Kohorten ist wesentlich, betonte Snoeckx. Randomisiert-kontrollierte Studien sind für die Zulassung solcher Techniken nicht gefordert und entsprechend selten verfügbar. Zumindest sollten die Algorithmen aber multizentrisch evaluiert werden. Bezüglich des LDCT zum Lungenkrebsscreening wäre nicht nur wichtig, verdächtige Rundherde auszumachen, sondern Algorithmen zu entwickeln, die möglichst genau pathologisch bestätigte Krebsherde entdecken können. Außerdem wird KI in Zukunft sicher auch eine Rolle in der leitliniengemäßen Kontrolle von Rundherden spielen, meint die Radiologin. Für die weitere Implementierung spielen dann auch juristische und ökonomische Fragen eine Rolle.