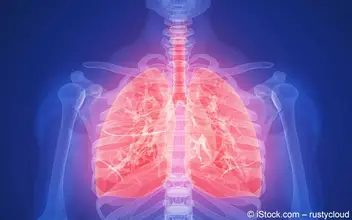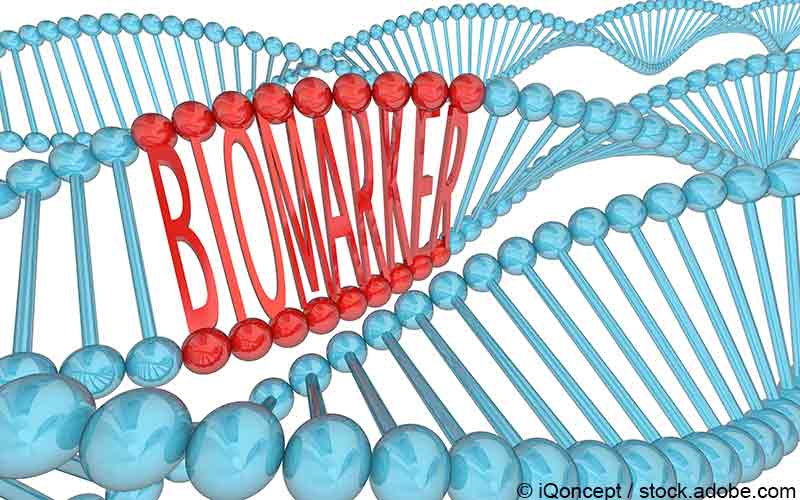
Die Entwicklung von Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) zur Behandlung von Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) mit einer aktivierenden Mutation im epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor (EGFR) stellt für die betroffenen Patienten einen prognostisch relevanten Fortschritt da. Eine „Liquid Biopsy“ aus dem Plasma kann helfen, Patienten für diese Therapie zu selektieren oder bei Rezidiv Therapie Resistenzmutationen zu identifizieren. Eine longitudinale Analyse des Bluts zeigt außerdem, dass sie auch einen späteren Progress vorhersagen kann, wie Dr. Adam Szpechciński vom Institut für Tuberkulose und Lungenerkrankungen in Warschau (Polen) berichtete [1].
mEGFR ctDNA als Verlaufsbiomarker
In der noch laufenden Studie hatte er zusammen mit seinem Team prospektiv ab Diagnose monatlich Blut von 45 Patienten mit EGFR-mutiertem NSCLC unter EGFR-TKI-Erstlinientherapie untersucht, um die Dynamik von zellfreier Tumor-DNA (ctDNA) des mutierten EGFR-Gens (mEGFR) im Verlauf zu prüfen, frühzeitig Resistenzmutationen zu entdecken und das klinische Ergebnis der Behandlung besser einschätzen zu können. Die Patienten wiesen meist eine Exon-19-Deletion (55%) oder eine L858R-Punktmutation (36%) im EGFR-Gen auf und wurden in der Erstlinie bis zum Progress mit Erlotinib, Gefitinib oder Afatinib behandelt.
ctDNA-Rückgang ist prognostisch relevant
Das mediane progressionsfreie Überleben (engl. Progression Free Survival, PFS) betrug 10 Monate, die Spanne lag bei 2-25 Monaten. 69% der Patienten wiesen im Plasma ctDNA des mEGFR auf, 31% nicht. Es zeigte sich ein signifikanter Unterschied im PFS zwischen Patienten, bei denen innerhalb von ein bis zwei Monaten nach TKI-Behandlungsstart eine bei Diagnose vorhandene mEGFR-ctDNA komplett verschwand, und den Patienten, bei denen diese ctDNA-Spiegel auf dem Ausgangniveau blieben oder sogar stiegen (medianes PFS 13 vs. 7 Monate; p<0,0036). Bei Patienten ohne detektiverbare ctDNA zu Studienbeginn fand sich diese auch im Verlauf nicht – die betreffenden Tumoren schienen keine ctDNA zu sezernieren.
Frühe Signale für Rezidiv/Progress
Einem Progress ging bereits bis zu neun Monate zuvor ein drastischer Anstieg in der mEGFR-ctDNA voraus. Eine T790M-Resistenzmutation fand sich bei elf Patienten (25%) zum Zeitpunkt des Progresses zusätzlich zur mEGFR in der ctDNA, war aber auch schon ein bis fünf Monate vorher detektierbar. Laut Szpechciński korrelierten die Befunde in der ctDNA bei Patienten, die zunächst auf die TKI-Therapie angesprochen und später ein Rezidiv entwickelt hatten, gut mit den Befunden aus dem Computertomographie-Monitoring. Demnach könnte die Liquid Biopsy genutzt werden, um die Wahrscheinlichkeit eines Progresses vorherzusagen und bei kompletter Clearance der mEGFR-ctDNA nach Therapiestart eine relativ günstige Prognose vorhersagen. Die Ergebnisse müssen aber zunächst an einer größeren Kohorte bestätigt werden.
Ansprechen auf Immuntherapie besser vorhersagen
Der Biomarker Programmed-Death-Ligand 1(PD-L1) wird zwar häufig bei der Immuntherapie des NSCLC eingesetzt, kann aber nur unzureichend das Ansprechen auf Checkpoint-Inhibitoren vorhersagen, erklärte Prof. Dr. Javier Ramos Paradas vom Spanischen Nationalen Krebsforschungszentrum CNIO in Madrid [2]. Er stellte anlässlich des ERS-Kongresses 2021 eine retrospektive Analyse immunologischer Profile von 196 Patienten mit einem frühen NSCLC vor. Es fanden sich dabei verschiedene Muster, die möglicherweise besser als prädiktive Biomarker geeignet sind.
Heiße und kalte Tumoren
Ausgewertet worden waren neben der Klinik molekulare Alterationen in der DNA-Sequenzierung, die Gen-Expression nach der RNA-Sequenzierung und die Infiltration mit Immunzellen sowie die PD-L1-Expression in der Immunhistochemie. Ramos Paradas berichtete, dass sich daraus vier unterschiedliche Subgruppen ableiten ließen, drei immunologisch heiße (hot) Tumorgruppen mit einer höheren Infiltration von CD4+, CD8+ und CD20+ Zellen und eine mit immunologisch kalten (cold) Tumoren, die je nach Histologie durch erworbene Mutationen in den Genen ARID1A, CARD11, CCND1, FGF3, FGF10, FGF19, MYC, NF1, NOTCH1, PIK3CA, PIK3CB und TFRC charakterisiert waren. Zusammen mit einer differenzielle Expression von Immunmarkern lassen sich so prädiktive Biomarker definieren, ist Ramos Paradas überzeugt.
Charakteristische Muster immunologisch relevanter Gene
Immunologisch heiße-Tumore zeigten Genaktivität bei Genen der adaptiven Immunantwort (CD28, FCRLA, JCHAIN, LY9, MS4A1, SLAMF7, TNFRSF9, TNFRSF17), der Antigenpräsentation (CD1C, CD1D), der Immunchemotaxis (CCL20, CCR4, CCR6) und der Immunregulation (CD53, PDCD1, SH2D1A). Dabei fanden sich drei unterschiedliche Cluster, die zur Bildung von Gruppen benutzt wurden. Immunologisch kalte Tumore waren durch Aktivität von Genen, die für Angiogenese (VEGFA), Zellzyklus (BUB1, CCNB2, FOXM1, MAD2L1, TOP2A), Wachstum, und Überleben (IGF1R), DNA-Replikation und Reparatur (KIAA0101) sowie Eisenstoffwechsel (HMBS, TFRC) eine Rolle spielen.
Die Befunde konnten bereits in einer unabhängigen Kohorte von Patienten mit frühem NSCLC bestätigt werden. Nun sollen Untersuchungen mit Patienten mit fortgeschrittenen NSCLC folgen, die mit einer Immuntherapie behandelt werden, um den prädiktiven Wert der immunologisch charakterisierten Gruppen zu untermauern.