Lamotrigin
Lamotrigin gehört zu den Antiepileptika der zweiten Generation und wird vor allem zur Therapie von Epilepsien, aber auch bei bipolaren Störungen, angewendet.
Lamotrigin: Übersicht
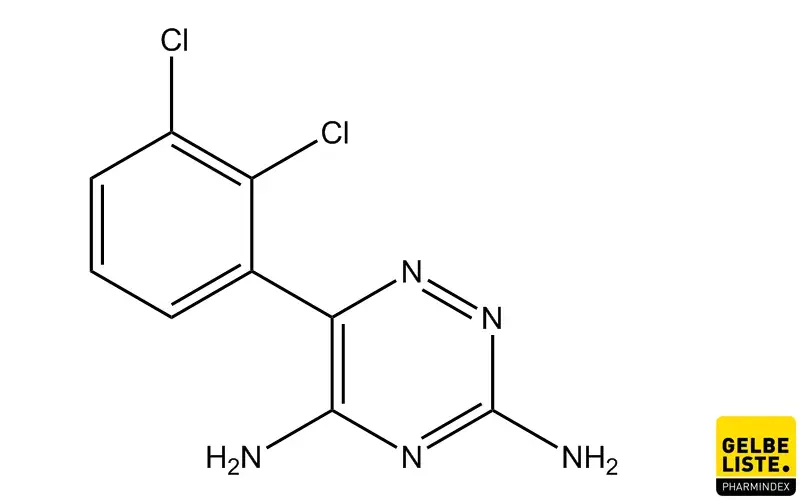
Anwendung
Der Wirkstoff Lamotrigin ist ein Antiepileptikum zweiter Generation. Es wird vor allem in der Therapie von Epilepsien eingesetzt. Wichtige Anwendungsgebiete sind Grand-Mal-Anfälle sowie fokale und psychomotorische Anfälle bei Patienten ab 12 Jahren. Bei fokalen Epilepsien ist es Mittel erster Wahl, bei Absence-Epilepsien und myoklonalen Anfällen Mittel zweiter Wahl. Für das Lennox-Gastaut-Syndrom darf Lamotrigin bereits ab dem 2. Lebensjahr angewendet werden. Als Antiepileptikum kann es entweder in Form einer Monotherapie eingesetzt werden oder als ergänzendes Arzneimittel zu anderen Präparaten.
Ferner wird Lamotrigin gegen Depressionen und in der Langzeitprophylaxe von bipolaren Störungen angewendet, wenn eine Vorbeugung mit Lithium nicht möglich oder nicht ausreichend wirksam ist.
Off-Label wird Lamotrigin mitunter zur Linderung der Symptome von Parkinson, Chorea Huntington und Migräne angewendet.
Wirkmechanismus
Lamotrigin gehört zur Wirkstoffgruppe der Antiepileptika der zweiten Generation. Es entfaltet seine Wirkung aber auf andere Weise als viele der herkömmlichen Antiepileptika. Üblicherweise wirken diese Medikamente gegen Epilepsien, indem sie direkt oder indirekt die Konzentration von Gammaaminobuttersäure (GABA) erhöhen und so eine krampflösende Wirkung vermitteln.
Lamotrigin hingegen fördert die Inaktivierung spannungsabhängiger Natrium- und Calciumkanäle in den Nervenzellen. Das dämpft die Erregbarkeit der Nervenzellen und verhindert gleichzeitig die Freisetzung der erregenden Neurotransmitter Aspartat und Glutamat. In der Folge wird die Erregungskaskade von vielen epileptischen Anfällen unterbrochen.
Die positiven Effekte von Lamotrigin auf psychische Erkrankungen, motorische Störungen und Schmerzen werden vermutlich ebenfalls durch die verringerte Reizweiterleitung verursacht.
Pharmakokinetik
Lamotrigin wird im Darm schnell und vollständig resorbiert. 55% des Lamotrigins sind an Plasmaproteine gebunden, seine Bioverfügbarkeit liegt bei 98%. Die maximale Plasmakonzentration wird nach 1,4 bis 4,8 Stunden erreicht, die Halbwertszeit beträgt 15 bis 60 Stunden, abhängig von weiteren, parallel gegebenen Arzneimitteln.
Eliminiert wird Lamotrigin vorrangig über Biotransformation mit UDP-Glukuronyltransferasen in pharmakologisch unwirksame Metaboliten. Die Ausscheidung erfolgt über den Urin.
Dosierung
Lamotrigin wird überwiegend in Tablettenform angewendet. Die angebotenen Dosierungen sind 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg und 200 mg. Die Dosierung wird an das Alter der Patienten angepasst und langsam auf die Ziel- oder Erhaltungsdosis gesteigert. Man unterscheidet zwischen einer Monotherapie mit Lamotrigin oder einer Zusatztherapie von Lamotrigin mit weiteren antiepileptisch wirkenden Medikamenten.
Epilepsien
Bei einer Monotherapie erhalten Erwachsene in der ersten und zweiten Woche einmal täglich 25 mg Lamotrigin pro Tag. In der dritten und vierten Woche wird die Therapie auf einmal täglich 50 mg gesteigert, bis die Ziel- oder Erhaltungsdosis von 100 bis 200 mg pro Tag, als Einzeldosis oder in zwei Einzeldosen aufgeteilt, erreicht ist. Dosissteigerungen sollten im Abstand von ein bis zwei Wochen angesetzt werden und maximal 50 bis 100 mg betragen. In Einzelfällen können Erhaltungsdosen von 500 mg pro Tag notwendig sein, um den notwendigen Erfolg zu erzielen.
Kinder und Jugendliche zwischen zwei und zwölf Jahren erhalten als Monotherapie bei typischer Absence-Epilepsie in Woche eins und zwei 0,3 mg pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. In der dritten und vierten Woche wird die Dosis auf 0,6 mg pro Kilogramm Körpergewicht und Tag erhöht. Anschließend kann die Dosis in Schritten von maximal 0,6 mg/kg/Tag alle ein bis zwei Wochen erhöht werden, bis entweder der gewünschte Effekt erreicht wurde oder eine Erhaltungsdosis von 1 bis 10 mg/kg/Tag erreicht ist. Die Medikation kann einmal täglich erfolgen oder in zwei Einzeldosen aufgeteilt werden.
Wird Lamotrigin als Zusatztherapie eingesetzt, ist die Dosierung abhängig von der Kombination mit anderen Arzneimitteln.
Bipolare Störungen
Bei bipolaren Störungen ist eine Behandlung mit Lamotrigin ab dem 18. Lebensjahr möglich. Für eine Monotherapie wird mit Dosen von einmal täglich 25 mg in Woche eins und zwei begonnen. Ab der dritten Woche wird die Dosierung auf 50 mg pro Tag erhöht, entweder einmal täglich oder als zwei Einzeldosen aufgeteilt. Ab der fünften Woche werden 100 mg pro Tag empfohlen, bis in der sechsten Woche die stabilisierende Zieldosis von 200 mg pro Tag erreicht ist. In klinischen Studien wurden zum Teil Dosen von 100 bis 400 mg/Tag eingesetzt, bis der gewünschte Effekt erreicht war.
Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren liegen keine ausreichenden Daten vor. Eine Gabe von Lamotrigin wird deshalb nicht empfohlen, um bipolare Störungen zu behandeln.
Nebenwirkungen
Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Lamotrigin zählen Hautreaktionen mit Ausschlägen, Fleckenbildungen und Juckreiz sowie Sehstörungen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, starke Reizbarkeit und Aggressivität. Häufige Nebenwirkungen von Lamotrigin sind sedierende wie psychomotorisch aktivierende Effekte, Magen-Darm-Beschwerden sowie Rücken- und Gelenkschmerzen.
Eine schwerwiegende Nebenwirkung ist das DRESS-Syndrom (Drug Rash with Eosinophilia and Systemics Symptoms). Dabei handelt es sich um eine seltene heftige Medikamentenreaktion, die meist zwei bis spätestens 8 Wochen nach Therapiebeginn mit Fieber, starken Gelenkschmerzen und Hautausschlägen sowie Funktionsstörungen von Nieren und Leber einhergeht. Andere Wirkstoffe, die ein DRESS-Syndrom auslösen können, sind beispielsweise Allopurinol, Carbamazepin, Dapson und Phenytoin. In gut 10% der Fälle verläuft das DRESS-Syndrom tödlich.
Im Folgenden sind Nebenwirkungen von Lamotrigin nach ihrer Häufigkeit aufgelistet.
Sehr häufig
- Kopfschmerzen
- Hautausschlag.
Häufig
- Aggressivität, Reizbarkeit
- Somnolenz
- Schwindel
- Tremor
- Insomnie
- Agitiertheit
- Übelkeit, Erbrechen, Diarrhö, Mundtrockenheit
- Arthralgie
- Müdigkeit
- Schmerzen
- Rückenschmerzen.
Gelegentlich
- Ataxie
- Diplopie
- Verschwommensehen.
Selten
- Nystagmus
- aseptische Meningitis
- Konjunktivitis
- Stevens-Johnson-Syndrom.
Sehr selten
- Blutbildveränderungen einschließlich Neutropenie, Leukopenie, Anämie, Thrombozytopenie, Panzytopenie, aplastischer Anämie und Agranulozytose
- Überempfindlichkeitssyndrom (einschließlich Symptomen wie Fieber, Lymphadenopathie, Gesichtsödem, abnorme Blut- und Leberwerte, disseminierte intravaskuläre Gerinnung, Multiorganversagen)
- Verwirrtheit
- Halluzinationen
- Tics
- Standunsicherheit
- Bewegungsstörungen
- Verschlimmerung der Parkinson-Krankheit
- extrapyramidale Nebenwirkungen
- Choreoathetose
- Zunahme der Anfallsfrequenz
- Leberversagen
- Leberfunktionsstörungen
- erhöhte Leberfunktionswerte
- toxisch epidermale Nekrolyse
- Lupus-ähnliche Reaktionen.
Nebenwirkungen mit unbekannter Häufigkeit
- Lymphadenopathie
- Arzneimittelexanthem mit Eosinophilie und systemischen Symptomen (DRESS).
Wechselwirkungen
Bekannte Wechselwirkungen treten bei folgenden Wirkstoffen auf und machen unter Umständen eine Dosisanpassung notwendig:
- Kontrazeptiva mit Ethinylestradiol oder Levonorgestrel => erhöhte Clearance von Lamotrigin um ca. das Zweifache.
- Valproat => erhöhte Halbwertszeit von Lamotrigin
- Phenytoin, Carbamazepin, Phenobarbital, Primidon, Rifampicin, Lopinavir/Ritonavir, Ethinylestradiol/Levonorgestrel-Kombinationen, Atazanavir/Ritonavir => beschleunigter Abbau von Lamotrigin
- Carbamazepin => mögliches Auftreten von zentralnervösen Störungen; verschwindet nach Dosisreduktion von Carbamazepin
- Oxcarbazepin => möglicherweise erniedrigte Lamotrigin-Spiegel
- Topiramat => Anstieg der Topiramatkonzentration
- Olanzapin => um 20 bis 24 % reduzierte AUC und Cmax von Lamotrigin möglich.
Kontraindikation
Bei einer Überempfindlichkeit gegen Lamotrigin oder sonstige Bestandteile des jeweiligen Präparates ist die Anwendung von Lamotrigin kontraindiziert.
Schwangerschaft/Stillzeit
Behandlungen mit Lamotrigin erhöhen das Risiko von kongenitalen Fehlbildungen. Eine Beratung durch den Facharzt wird empfohlen. Ist eine fortgeführte Therapie mit Lamotrigin während der Schwangerschaft notwendig, sollte die niedrigste mögliche Dosis gewählt werden. Unter Umständen ist auch eine zusätzliche Gabe von Folsäure ratsam. Da der Plasmaspiegel von Lamotrigin durch die Schwangerschaft und Entbindung beeinflusst werden kann, wird ebenfalls empfohlen, regelmäßige Kontrollen anzusetzen.
Da Lamotrigin in die Muttermilch übergehen kann, sollten die Nutzen und Risiken des Stillens beim Säugling während einer Lamotrigintherapie abgewogen werden. Der Säugling muss hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen überwacht werden.
Verkehrstüchtigkeit
Da sich die Lamotrigintherapie bei jedem Patienten unterschiedlich auswirkt, muss das Risiko jeweils im Arzt-Patienten-Gespräch abgewogen werden und gesetzliche Regulationen zur Anfallsfreiheit eingehalten werden.
Weitere Informationen können Sie der jeweiligen Fachinformation entnehmen.
Wirkstoff-Informationen
- Freissmuth M, Offermanns S, Böhm, S. Pharmakologie und Toxikologie. 2., aktualisierte und erweiterte Auflage. Heidelberg: Springer-Verlag, 2016.
- Aktories K, Förstermann U, Hofmann F, Starke K. Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie. 12. Auflage. München: Elsevier, 2017.
- Gelbe Liste Pharmindex: https://www.gelbe-liste.de/wirkstoffe/Lamotrigin_19484
- ALIUD PHARMA. Fachinformation Lamotrigin AL Tabletten [Internet]. Zuletzt aktualisiert Juni 2014. [zitiert am 28.12.2018]. URL: http://fachinformation.srz.de/pdf/aliudpharma/lamotriginal5mg-25mg-50mg-100mg-200mgtabletten.pdf
- U.S. National Library of Medicine – National Center for Biotechnology Information. Compound Summary for CID 3878 – Lamotrigin [Internet]. Zuletzt aktualisiert: 22.12.2018. [zitiert am 28.12.2018]. URL: https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3878#section=Top
-
Lamictal 2 mg Kautabletten bzw. Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
-
Lamictal 5 mg Kautabletten bzw. Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
-
Lamictal 25 mg Kautabletten bzw. Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
-
Lamictal 50 mg Kautabletten bzw. Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
-
Lamictal 100 mg Kautabletten bzw. Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
-
Lamictal 200 mg Kautabletten bzw. Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG
-
Lamotrigin - 1 A Pharma® 25 mg Tabletten
1 A Pharma GmbH
-
Lamotrigin - 1 A Pharma® 50 mg Tabletten
1 A Pharma GmbH
-
Lamotrigin - 1 A Pharma® 100 mg Tabletten
1 A Pharma GmbH
-
Lamotrigin - 1 A Pharma® 200 mg Tabletten
1 A Pharma GmbH
-
Lamotrigin AbZ 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
AbZ-Pharma GmbH
-
Lamotrigin acis 25 mg Tabletten
acis Arzneimittel GmbH
-
Lamotrigin acis 50 mg Tabletten
acis Arzneimittel GmbH
-
Lamotrigin acis 100 mg Tabletten
acis Arzneimittel GmbH
-
Lamotrigin acis 200 mg Tabletten
acis Arzneimittel GmbH
-
Lamotrigin AL 50 mg Tabletten
ALIUD PHARMA® GmbH
-
Lamotrigin AL 100 mg Tabletten
ALIUD PHARMA® GmbH
-
Lamotrigin AL 200 mg Tabletten
ALIUD PHARMA® GmbH
-
Lamotrigin Aristo® 25 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Aristo Pharma GmbH
-
Lamotrigin Aristo® 50 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Aristo Pharma GmbH
-
Lamotrigin Aristo® 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Aristo Pharma GmbH
-
Lamotrigin Aristo® 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Aristo Pharma GmbH
-
Lamotrigin Atid® 25 mg Tabletten
DEXCEL Pharma GmbH
-
Lamotrigin Atid® 50 mg Tabletten
DEXCEL Pharma GmbH
-
Lamotrigin Atid® 100 mg Tabletten
DEXCEL Pharma GmbH
-
Lamotrigin Atid® 200 mg Tabletten
DEXCEL Pharma GmbH
-
Lamotrigin Aurobindo 5 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
PUREN Pharma GmbH & Co. KG
-
Lamotrigin Aurobindo 25 mg Tabletten
PUREN Pharma GmbH & Co. KG
-
Lamotrigin Aurobindo 50 mg Tabletten
PUREN Pharma GmbH & Co. KG
-
Lamotrigin Aurobindo 100 mg Tabletten
PUREN Pharma GmbH & Co. KG
-
Lamotrigin Aurobindo 200 mg Tabletten
PUREN Pharma GmbH & Co. KG
-
Lamotrigin axcount 25 mg Tabletten
axcount Generika AG
-
Lamotrigin axcount 50 mg Tabletten
axcount Generika AG
-
Lamotrigin axcount 100 mg Tabletten
axcount Generika AG
-
Lamotrigin axcount 200 mg Tabletten
axcount Generika AG
-
Lamotrigin beta 50 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
betapharm Arzneimittel GmbH
-
Lamotrigin beta 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
betapharm Arzneimittel GmbH
-
Lamotrigin beta 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
betapharm Arzneimittel GmbH
-
lamotrigin-biomo 50 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
biomo pharma GmbH
-
lamotrigin-biomo 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
biomo pharma GmbH
-
Lamotrigin-CT 50 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
AbZ-Pharma GmbH
-
Lamotrigin-CT 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
AbZ-Pharma GmbH
-
Lamotrigin Desitin® 5 mg Tabletten
Desitin Arzneimittel GmbH
-
Lamotrigin Desitin® 50 mg Tabletten
Desitin Arzneimittel GmbH
-
Lamotrigin Desitin® 100 mg Tabletten
Desitin Arzneimittel GmbH
-
Lamotrigin Desitin® 200 mg Tabletten
Desitin Arzneimittel GmbH
-
Lamotrigin Desitin® quadro 100 mg Tabletten
Desitin Arzneimittel GmbH
-
Lamotrigin dura 25 mg, Tabletten
Viatris Healthcare GmbH
-
Lamotrigin dura 50 mg, Tabletten
Viatris Healthcare GmbH
-
Lamotrigin dura 100 mg, Tabletten
Viatris Healthcare GmbH














