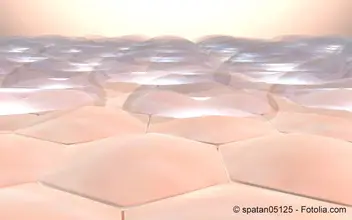70 bis 95% aller Heranwachsenden entwickeln Akne - meist harmlose Pubertätspickel, doch bei etwa 10% der Fälle handelt es sich um persistierende Verläufe, bei denen die Patienten auch über das 25. Lebensjahr hinaus unter den typischen Hautläsionen zu leiden haben.
Langjähriger Forschungsschwerpunkt: Akne-Impfung
Um den Betroffenen zu helfen, arbeiten die Dermatologen unter Professor Chuang-Ming Huang von der Universität San Diego (Kalifornien, USA) schon seit Jahren an einer Impfung gegen die Pickel.
In einer 2008 im Wissenschaftsmagazin Plos One veröffentlichten Arbeit hatte die Arbeitsgruppe eine bestimmte Neuraminidase in der Zellwand von Propionibakterium acnes als Zielstruktur gewählt. Dieses Enzym ist für die Adhäsion von P. acnes an die Zielzelle und somit für dessen Zytotoxizität entscheidend. Gibt man Mäusen ein Serum mit Antikörpern gegen dieses Enzym, entwickeln sie deutlich geringere Akne-Läsionen und setzen auch weniger von dem proinflammatorischen Zytokin MIP-2 (Makrophagen-inflammatorisches Protein 2) frei [1].
Zielstruktur CAMP-Faktor
Die US-amerikanischen Dermatologen arbeiteten weiter an der Akne-Impfung und konnten vor kurzem eine weitere Arbeit dazu vorlegen. Diesmal konzentrierten sie sich auf den Christie-Atkins-Munch-Peterson- (CAMP)-Faktor– ein Toxin, das von P.acnes produziert wird. CAMP gilt als proinflammatorischer Faktor bei der Akne [2].
Werden Mäuse mit dem CAMP-Faktor geimpft, bilden sie Antikörper dagegen. Bei einer Infektion mit P.acnes sorgt dies offenbar dafür, dass deutlich weniger proinflammatorische Zytokine produziert werden - so sinkt beispielsweise die Produktion von MIP-2, einer murinen Entsprechung des menschlichen proinflammatorischen Interleukin-8 (IL-8).
Weniger proinflammatorische Zytokine
Nicht nur im Maus-Modell konnte die verminderte Entzündungsreaktion nachgewiesen werden. Auch ex vivo in menschlichem Gewebe, genauer gesagt an Akne-Explantaten und Biopsien normaler Haut, konnte dies belegt werden. CAMP-Faktor sowie die proinflammatorischen Zytokine IL-8 und IL-1β werden in den Akne-Läsionen stärker exprimiert als in Haut ohne Läsionen. Wurden die verschiedenen Gewebeproben mit gegen CAMP gerichteten Antikörpern inkubiert, sanken die Konzentrationen von IL-8 und IL-1β deutlich.
Nutzen für andere P.acnes-Erkrankungen?
Wie die Autoren in der Diskussion bemerken, ließen sich die Erkenntnisse zu den Entzündungsprozessen möglicherweise auch bei anderen Erkrankungen mit P.acnes-Beteiligung nutzen − beispielsweise beim Prostatakarzinom, Krankheiten in Zusammenhang mit der Anwendung von Polymeren oder polymerhaltigen Produkten, Sepsis, toxischem Schock-Syndrom, Endokarditis, Osteomyelitis und verschiedenen operationsbedingten Infektionen.
Diese Ergebnisse von Wang et al. [2] waren Professor Emmanuel Contassot von der Universität Zürich einen Kommentar im Journal of Investigative Dermatology wert [3]. So sei das Wissen um die Bedeutung des CAMP-Faktors bei der Entzündung entschlüsselt und mit der Impfung ein Weg aufgezeigt worden, mit dem sich möglicherweise die Nebenwirkungen der bei Akne gängigen Medikamente wie Antibiotika und Retinoide umgehen lassen.