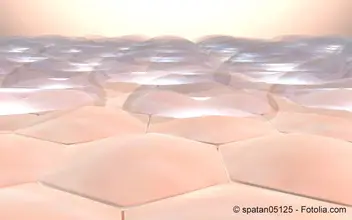Krankheiten – das betrifft auch Hauterkrankungen – können sich bei Künstlern sehr unterschiedlich auswirken. Sie können durch die geistige Verarbeitung erst die Werke ermöglichen oder beflügeln, sie können aber auch fatale Folgen haben, schlicht weil der Künstler körperlich nicht in der Lage ist zu arbeiten. Im Extremfall setzt der Tod der Kunst ein Ende.
Charles Bukowski
Ein Beispiel für die literarische Auseinandersetzung mit Akne ist das Werk von Charles Bukowski (1920-1994). Der in Deutschland geborene US-Kultautor hat in seinem teils biographischen Buch „Das Schlimmste kommt noch“ seine Acne conglobata verarbeitet. Sein Protagonist Henry „Hank“ Chinaski schildert darin “Pickel, groß wie Walnüsse, im Gesicht und am ganzen Körper sowie gelben Eiter, der an den Spiegel klatsche”. Mit den entstellenden schmerzhaften Abszessen, deren Narben auch auf seinen Altersbildern noch zu sehen sind, gingen auch vielfach Ablehnung und Demütigungen (auch von seitn des Vaters) für den Jugendlichen Charles einher. Im Los Angeles County General Hospital wird Bukowski von einem Arzt als schlimmster Fall von Akne vorgestellt, der ihm je untergekommen sei. Für Bukowski war das Schreiben sein Instrument, um mit seinem Außenseiterdasein und den Schmerzen fertig zu werden: „Das Wort ist der Zaubertrank, der uns davor bewahrt uns umzubringen.“
Johann Wolfgang von Goethe
Auch Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) hat Krankheit und Schmerz – auch seelischen – schon in seiner Jugend literarisch zu bewältigen versucht. Am bekanntesten ist sein Briefroman “Die Leiden des jungen Werthers” in der er seine unerfüllte Liebe zu Charlotte Buff verarbeitet. Goethe war auch körperlich häufig krank. Die Leiden reichten von häufigen grippalen Infekten über anhaltende Verdauungsbeschwerden bis zu Rheuma, Herz- und Kreislaufstörungen und üblen Zahnschmerzen. In Briefen und Tagebüchern beschreibt er seine körperlichen Befindlichkeiten, die sicher auch Einfluss auf sein Werk hatten. Besonders gravierend dürfte allerdings eine Erkrankung sein, die beinahe den “Faust” gekostet hätte.
Am “Faust” arbeitete Goethe schon seit 1770, seit er den Fall der Kindsmörderin Susanna Margareta Brandt verfolgt hatte. Ab 1797 fügte Goethe dem Urfaust, Szenen hinzu. Auch 1801 arbeitet er an der Tragödie erster Teil, als der damals 51-Jährige an einem sich allmählich verschlechternden Infektion erkrankte: Unter hohem Fieber entwickelte sich auf der linken Gesichtshälfte eine eitrige Entzündung, die teilweise Blasen bildete und auf das linke Auge übergriff, sodass Goethe es nicht mehr öffnen konnte. Offenbar war die Trias Erythem, Fieber und vermutlich auch Lymphadenitis erfüllt, so dass man heute von einer bullösen Form des Gesichtserysipels ausgeht. Bei etwa 13% der Betroffenen manifestiert sich das Erysipel im Gesicht.
Nach und nach breitete sich die Entzündung auf Gaumen, Rachen, und Kehlkopf aus, begleitet von „Krampfhusten“ und Erstickungsanfällen. Über mehrere Tage war Goethe benommen oder delirant. Diese Krise dauerte neun Tage an, dann besserte sich der Zustand allmählich. Doch es dauerte Monate, bis er wieder völlig hergestellt war. Erst 1808 gelangte “Faust - der Tragödie 1.Teil” in Druck.
Melanom brachte Bob Marley um
So sehr sich Goethe mit seiner Gesundheit beschäftigte, so wenig tat dies Bob Marley (1945-1981). Die Ikone des Reggea ist bis heute durch seine Songs wie “Buffalo Soldier”, “Get Up, Stand Up”oder “I Shot the Sheriff” weltbekannt. Neben seinem musikalischen Werk verbreitete Marley die Botschaft der Rastafari-Bewegung. Für deren Anhänger war und ist Marley eine wichtige Identifikationsfigur.
Doch dieser Kult war vermutlich einer der Gründe für seinen frühen Tod. Seit 1977 litt Marley an einer ständig wieder aufflammenden Wunde am rechten großen Zeh, die er sich seinen Angaben nach beim Fußballspielen zugezogen hatte. Später wurde ein Melanom diagnostiziert, dass Marley aber aufgrund seiner Rastafari-Ideologie nicht lege artis behandeln ließ. Das heißt, er lehnte eine Zehenamputation ab. Lediglich Nagel und Nagelbett wurden entfernt und ein kleiner Hautlappen vom Oberschenkel transplantiert.
Als sich Marley zur Vorbereitung eines großen Konzerts in New York aufhielt, brach er beim Joggen im Centralpark zusammen. Dabei stellte sich heraus, dass bereits in Leber, Lunge und Gehirn Metastasen bestanden. Nachdem ihm eine Lebenserwartung von nur noch wenigen Wochen prognostiziert wurde, suchte Marley die Klinik von Dr. Josef Issels in Rottach-Egern auf. Diese war auf Krebspatienten mit infauster Prognose spezialisiert und wandte häufig Methoden an, die von der Fachwelt nicht anerkannt wurden. Dort verlor Marley durch die Chemotherapie seine Dreadlocks, was für ihn als religiösen Rastafari eine Katastrophe darstellte. Am 8. Mai 1981 beschloss er, zum Sterben nach Jamaika zurückzukehren. Bei der Zwischenlandung in Florida war er jedoch schon zu schwach für den Weiterflug. Bob Marley starb dort am 11. Mai 1981 gegen 11.30 Uhr im Alter von 36 Jahren. Er wurde in seinem Heimatdorf Nine Miles auf Jamaika mit einer Bibel, seiner roten Gibson-Gitarre, einem Marihuanazweig und einem Ring, der ihm von Haile Selassie persönlich bei einer Privataudienz geschenkt worden sein soll, beigesetzt.