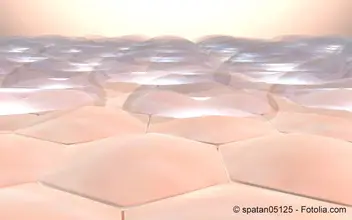Anlässlich der Tagung „Dermatologie KOMPAKT & PRAXISNAH“ diskutierten Kollegen über die Problematik der nicht-rechtzeitigen Hautkrebsfrüherkennung.
„Eine verschleppte Diagnose birgt insbesondere beim schwarzen Hautkrebs, dem malignen Melanom, das hohe Risiko, dass der Tumor bereits gestreut hat, was die Prognose deutlich verschlechtert“, warnt der Vizepräsident des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen, Dr. Thomas Stavermann.
Risiko größerer Dicke beim malignen Melanom
Beim malignen Melanom ist unter anderem die Tumordicke ein wichtiger Parameter für die Überlebenschance der Betroffenen. Das Risiko für die Entstehung von Metastasen erhöht sich bereits ab einer Dicke von 1,01 Millimeter.
Früherkennung auch bei weißem Hautkrebs wichtig
Aber nicht nur der gefährlichere schwarze Hautkrebs sollte frühestmöglich erkannt werden, auch beim weniger gefährlichen, aber viel häufigeren hellen Hautkrebs, der insbesondere als Basalzellkarzinom und Plattenepithelkarzinom auftritt und nur sehr selten metastasiert, sollte möglichst frühzeitig erkannt werden, um die häufig notwendigen Operationen ohne Komplikationen durchführen zu können, besonders bei Tumoren im Gesicht sowie in anderen sichtbaren Körperarealen.
„Gerade beim hellen Hautkrebs sehen wir – beispielsweise im Augenbereich – häufiger größere Tumore bei der Erstdiagnose als vor der Pandemie. Dies erfordert wiederum häufiger eine Überweisung in die Klinik, was wegen mangelnder Kapazitäten schwierig ist“, erläutert Dr. Stavermann die Erfahrungen aus seiner Berliner Großpraxis mit rund 6.500 Patientenkontakten pro Quartal. Außerdem sind während der Pandemie Patientinnen und Patienten verzögert zu Befundbesprechungen und auch seltener zur Nachsorge erschienen. „Insbesondere die Älteren und Ängstlichen sind bei den Früherkennungsuntersuchungen zurückhaltender geworden“, so Dr. Stavermann.
Sinkende Hautscreening-Zahlen
Wie das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) mitteilt, sank in der letzten Märzwoche 2020 mit Beginn der Pandemie die Fallzahl beim gesetzlichen Hautkrebsscreening um ca. 70 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und wurde auch in den anschließenden Quartalen blieb die Inanspruchnahme der Hautkrebsfrüherkennungsuntersuchung unter dem Vorjahresniveau. Der Trend setzte sich im ersten Halbjahr 2021 mit einem durchschnittlichen Minus von 14,3 % im Vergleich zu 2019 fort.
Nicht nur der Pandemie geschuldet
Zwar ist mit Sicherheit die Pandemie einer der Gründe, warum es zu einer geringeren Nutzung des Hautkrebsscreenings kam, aber nicht den einzige. Denn durch die geringe Zahl an ambulant tätige Dermatologen, führen seit 2008 auch Allgemeinmediziner das gesetzliche Hautkrebsscreening durch, häufig im Rahmen der Allgemeinen Gesundheitsuntersuchung (ehemals Check-up 35). Dieser Check-up stand bis 2019 allen Versicherten ab 35 Jahren alle zwei Jahre zu, sodass das Hautkrebsscreening passenderweise gleichzeitig durchgeführt werden konnte. Die 2019 eingeführte Allgemeinen Gesundheitsuntersuchung dürfen gesetzlich Versicherte aber nur noch alle drei Jahre in Anspruch nehmen. „Das reißt die beiden Untersuchungen zeitlich auseinander, wodurch das gesetzliche Hautkrebsscreening sicherlich auch seltener in Anspruch genommen wird“, erläutert Dr. Stavermann. „Insgesamt stellen wir fest, dass deutlich weniger Patienten zur Abklärung einer Hautveränderung mit einer Überweisung vom Hausarzt zum Dermatologen kommen.“
Versorgungslast kann steigen
Möglicherweise kehrt sich der Trend einer geringeren Zahl von Hautkrebsdiagnosen in den Pandemiejahren in den Folgejahren um – bei zusätzlich größeren Tumoren bei der Entdeckung. Das wird die ohnehin schon große Versorgungslast der Dermatologen noch zusätzlich steigern.
„Als Berufsverband rufen wir daher seit Jahren dazu auf, das gesetzliche Hautkrebsscreening in Anspruch zu nehmen, aber auch eine regelmäßige Selbstinspektion der Haut durchzuführen und bei verdächtigen Veränderungen einen Hautarzt aufzusuchen“, unterstreicht Dr. Stavermann.