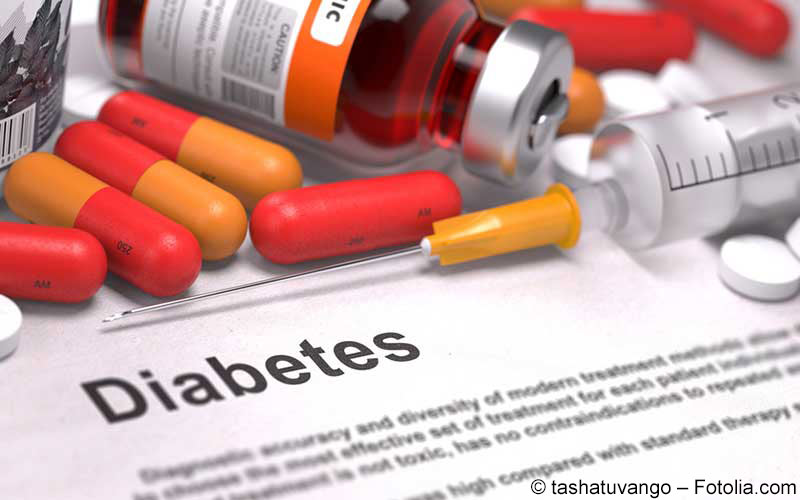
Forscher eines internationalen Netzwerks analysierten gesundheitsbezogene Daten von 246 Millionen Patienten und fanden einen geringfügigen Vorteil von Dipeptidyl-Peptidase 4-Inhibitoren gegenüber Sulfonylharnstoffen bezüglich Myokardinfarkt und Augenerkrankungen. Dieser Befund stützt die Empfehlung der American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology von 2017.
Hintergrund
Sofern nicht kontraindiziert erhalten Patienten mit Typ-2-Diabetes (T2D) entsprechend bestehender Behandlungsleitlinien Metformin als Erstlinientherapie. Wenn der T2D unkontrolliert bleibt, muss aus den vielfältigen Optionen wie Sulfonylharnstoffen, Dipeptidyl-Peptidase 4 (DPP-4)-Inhibitoren, α-Glukosidase-Inhibitoren, Natrium-Glukose-Cotransporter 2-Inhibitoren, Glukagon-ähnliches Peptid-1-Rezeptor-Agonisten und Thiazolidindionen ein Zweitlinienmedikament gewählt werden. Im Gegensatz zur Erstlinientherapie besteht über die effiziente Zweitlinienbehandlung des T2D kein eindeutiger Konsens und es gibt große Unterschiede in der Versorgungspraxis.
Beim Netzwerk Observational Health Data Sciences and Informatics (OHDSI, Netzwerk für Gesundheitsdaten auf Beobachtungsgrundlage und Informatik) handelt es sich um eine internationale Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Wert von in großem Maßstab analysierten Gesundheitsdaten zu untersuchen. Die Forscher nutzen Daten aus elektronischen Krankenakten und Versicherungsunterlagen, um über die Analyse dieser Daten aus der medizinischen Praxis Grundlagen für zukünftige Behandlungsentscheidungen zu generieren.
Zielsetzung
Im vorgestellten Projekt gingen die Forscher der Frage nach, ob die Wirksamkeit der Zweitlinienbehandlung des T2D nach initialer Therapie mit Metformin über ein offenes Verbundforschungsnetzwerk dargestellt werden kann.
Konkret sollten diejenigen Arzneimittelklassen unter Sulfonylharnstoffen, DPP-4-Inhibitoren und Thiazolidindionen identifiziert werden, welche bei Patienten mit T2D und Metformin als Erstlinientherapie mit verminderten Spiegeln von Hämoglobin A1c (HbA1c) und geringerem Risiko für Herzinfarkt, Nierenerkrankungen und Augenerkrankungen assoziiert waren [1].
Methodik
Berücksichtigt wurden Daten von Patienten mit T2D, die mit Metformin behandelt worden waren, und bei denen mindestens ein vorheriger HbA1c-Labortest vorlag. Für die Patienten musste in der Folge entweder eine Verschreibung von Sulfonylharnstoffen, DPP-4-Inhibitoren oder Thiazolidindionen vorliegen.
Der primäre Ergebnisparameter war die erste Beobachtung der Reduktion des HbA1c-Spiegels auf 7% des Gesamthämoglobins oder weniger nach Verschreibung eines Zweitlinientherapeutikums. Sekundäre Parameter waren das Auftreten eines Myokardinfarkts und von Nieren- und Augenerkrankungen.
Es wurden medizinische Datensätze aus acht Quellen in drei Ländern genutzt. Die Daten wurden in ein einheitliches gemeinsames Datenmodell überführt und unter Verwendung von Open-Source-Instrumenten analysiert. Es wurden für jedes Studienzentrum Hazard Ratios (HR) der Zielparameter bestimmt. Mittels Meta-Analysen wurden diese zu Konsensus-HR für jede Zweitlinientherapie zusammengeführt.
Ergebnisse
Insgesamt wurden die Daten von 246.558.805 Patienten (126.977.785 Frauen [51,5%]) analysiert. Bei Patienten mit T2D zeigten Sulfonylharnstoffe, DPP-4-Inhibitoren und Thiazolidindione im Anschluss an eine Metforminverordnung keine Unterschiede in der wirksamen Senkung des HbA1c-Spiegels auf 7% oder weniger des Gesamthämoglobins.
Patienten, die mit Sulfonylharnstoffen behandelt worden waren, zeigten im Vergleich zu Patienten, die DPP-4-Inhibitoren erhalten hatten, ein geringfügig höheres Risiko, einen Myokardinfarkt (Konsensus-Hazard Ratio 1,12; 95% CI, 1,02-1,24) und Augenerkrankungen (Konsensus-Hazard Ratio 1,15; 95% CI, 1.11-1.19) zu erleiden. Das Risiko für Nierenerkrankungen war für die drei untersuchten Zweitlinientherapeutika gleich groß.
Fazit
Bei Patienten mit T2D und Metformin unterschieden sich die untersuchten Zweitlinientherapieoptionen weder in der Senkung des HbA1c-Spiegels noch im Risiko, eine Nierenerkrankung zu erleiden. In der Meta-Analyse zeigte sich für Sulfonylharnstoffe ein geringfügig höheres Risiko für Myokardinfarkt und Augenerkrankungen verglichen mit DPP-4-Inhibitoren. Der Befund stützt die aktuellen Empfehlungen der American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology, die DPP-4-Inhibitoren den Vorzug geben.
Der Ansatz, große Mengen vorhandener gesundheitsbezogener Patientendaten aus verschiedenen Ländern und Gesundheitssystemen zu standardisieren und im Rahmen eines multinationalen, offenen Forschungsnetzwerks gemeinsam auszuwerten, hat sich nach Meinung der Forscher bewährt. Es könnten so Fragen beantwortet werden, auch wenn die Durchführung kontrollierter Studien nicht möglich ist.
Trotz der umfassenden Datenlage sollten die Ergebnisse bezüglich möglicher Verzerrungsfaktoren wie Patientenkollektiv und Verschreibungspraxis in verschiedenen Erstattungssystemen mit Vorsicht interpretiert werden.
Die Studie wurde von verschiedenen öffentlichen Geldgebern, pharmazeutischen Unternehmen und einer Stiftung finanziell unterstützt.









