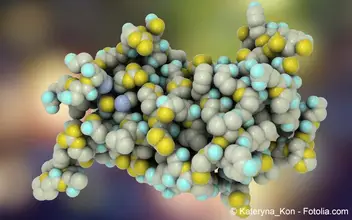Vor dem Hintergrund des Beschusses des Atomkraftwerks Saporischschja in der Ukraine sei das Interesse an Jod groß, heißt es in einer Pressemitteilung der DGE. Neben der vorbeugenden Einnahme des Spurenelements zum Schutz der Schilddrüse vor radioaktivem Jod gerate jedoch aus dem Fokus, dass Deutschland nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wieder zu einem Jodmangelgebiet geworden ist. Als Hauptgrund für diese Situation nennt die DGE die reduzierte Nutzung von jodiertem Speisesalz in der professionellen Lebensmittelverarbeitung. Problematisch dabei ist, dass ein Jodmangel zu verschiedenen Erkrankungen der Schilddrüse führen kann. Schwangere sind hier besonders gefährdet, da sich ein Jodmangel auf die geistige und körperliche Entwicklung des Kindes auswirken kann.
Wichtiges Spurenelement
Jod ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das zur Bildung der Schilddrüsenhormone Thyroxin (T4) und Trijodthyronin (T3) benötigt wird. Diese sind unter anderem beteiligt an der körperlichen und geistigen Entwicklung, verschiedenen Stoffwechselwegen sowie der Regulation des Temperaturempfindens.
Die empfohlene Tageszufuhr beträgt 150 µg bis 200 µg Jod. Schwangeren und Stillenden wird zur doppelten Menge geraten.
Rückläufige Nutzung von jodiertem Speisesalz
Die rückläufige Jodversorgung, die das Robert-Koch-Institut (RKI) dokumentiert, sei hauptsächlich auf einen geringeren Einsatz von jodiertem Speisesalz in der professionellen Lebensmittelverarbeitung zurückzuführen, erklärt Professor Dr. med. Joachim Feldkamp, Direktor der Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Endokrinologie, Diabetologie und Infektiologie am Klinikum Bielefeld. In der Lebensmittelindustrie werde aus Kostengründen vermehrt die jodfreie Salzvariante verwendet. Da in verschiedenen Ländern unterschiedliche Regularien bezüglich der Jodierung von Speisesalz gelten, werde zudem oft der zulassungstechnisch einfachere und kostengünstigere Weg ohne jodiertes Salz eingeschlagen, so Feldkamp weiter.
Ein weiterer Faktor sei, dass einige Konsumenten vermehrt bewusst unjodiertes Salz nutzten oder auf kochsalzarme Ernährung setzten, was die Mangelsituation verstärke.
Gefahren des Jodmangels
Bei schlechter Versorgung mit Jod können insbesondere Veränderungen der Schilddrüse, wie eine Vergrößerung oder Knoten auftreten. Ein Jodmangel führt häufiger zu sogenannten „heißen Knoten“, gutartigen hyperfunktionellen Knoten der Schilddrüse, die zu einer Überfunktion des Organs führen können. Dabei treten Anzeichen wie Schwitzen, Pulsbeschleunigung, Durchfall, Gewichtsabnahme, Unruhe, Schlafstörungen, Ängste und Konzentrationsstörungen auf. Des Weiteren sind Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern möglich.
Entwicklungsstörungen ungeborener Kinder
Schwangere haben, wie bereits erwähnt, einen etwa doppelt so hohen Bedarf an Jod. Ursache dafür ist ein beschleunigter Stoffwechsel und eine dadurch erhöhte Ausscheidung im Urin. Bereits ein leichter Mangel kann den Intelligenzquotienten des Kindes beeinträchtigen. Auch eine Beeinträchtigung der körperlichen Entwicklung ist bei einem Jodmangel möglich.
Empfehlungen zur Supplementation
Die DGE sowie die Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) empfehlen allen Frauen in Schwangerschaft und Stillzeit die Supplementation von Jod. Auch bei Personen, die bei der Ernährung auf tierische Lebensmittel verzichten, kann eine ergänzende Zufuhr des Spurenelements nötig sein.
Personen, die bewusst auf den Verzehr jodhaltiger Lebensmittel, inklusive jodiertem Speisesalz, achten und häufig selbst kochen, benötigen in der Regel keine Supplementation. Die häufige Zufuhr von Fertiggerichten wirke sich jedoch auf die Versorgung aus, so Feldkamp.
Vorsicht bei Schilddrüsenüberfunktion
Die Supplementation von Jod sollte jedoch erst nach ärztlicher Beratung erfolgen, um eine Schilddrüsenüberfunktion zu verhindern. Bei einer bestehenden Überfunktion oder bösartigen Schilddrüsenerkrankung ist besondere Vorsicht geboten.