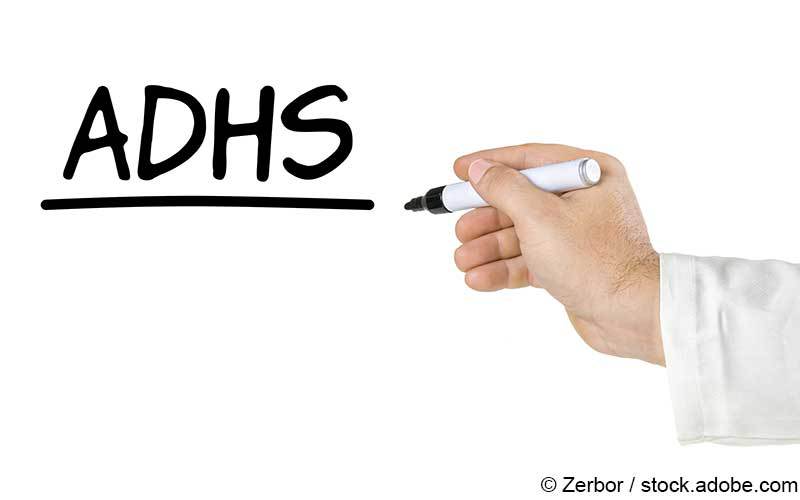
Hintergrund
Die Diagnosehäufigkeit der Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei Kindern und Jugendlichen hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Die Ursachen dafür sind umstritten. Häufig wird eine Überdiagnostizierung angeführt, aber eine umfassende Evaluierung von Daten für oder gegen eine Überdiagnostizierung gab es bislang nicht. Diese ist jedoch für eine evidenzbasierte und patientenorientierte Diagnostik und Behandlung dringend erforderlich [1].
Zielsetzung
Luise Kazda und ihre Kollegen von der Sydney School of Public Health der University of Sydney, Australien, verschafften sich anhand eines systematischen „Scoping Reviews“ einen Überblick über vorhandene Daten hinsichtlich Überdiagnose und Überbehandlung von ADHS bei Kindern und Jugendlichen und stellten Forschungslücken heraus.
Methodik
Vier große Datenbanken (MEDLINE, Embase, PsychINFO und Cochrane Library) wurden nach Studien zu Kindern und Jugendlichen mit ADHS durchsucht, die zwischen Januar 1979 und August 2020 in englischer Sprache erschienen waren. Von 12267 potenziell relevanten Studien zu der Thematik gingen 334 Studien in die Analyse ein. Dabei handelte es sich um 61 sekundäre und 273 primäre Forschungsarbeiten. Die Mehrzahl der Studien (n=217) wurde in den letzten 10 Jahren publiziert. Die Daten stammten größtenteils aus Nordamerika (n=128), Europa (n=93) oder Ozeanien/Asien (n=35).
Eine Überdiagnose war als solche definiert, wenn eine Person mit ADHS diagnostiziert wurde, der Nettoeffekt der Diagnose sich jedoch nachteilig auswirkte. Fehldiagnosen und falsch positive Diagnosen waren nicht im Fokus der Arbeit. Konzeptionelle Grundlage der Arbeit waren fünf übergreifende Fragestellungen („framework questions“), die generell zur Identifizierung von Überdiagnostizierung und Überbehandlung in nicht-karzinogenen Situationen definiert wurden:
- Gibt es ein Potenzial für zunehmende Diagnosen?
- Gibt es einen tatsächlichen Anstieg an Diagnosen?
- Sind die zusätzlich diagnostizierten Fälle subklinisch bzw. mit niedrigem Risiko?
- Wurden einige der zusätzlichen Fälle behandelt?
- Könnte der Schaden den Nutzen einer Diagnose und Behandlung überwiegen?
Ergebnisse
In 104 Studien wurden Belege dafür gefunden, dass ein Reservoir an ADHS und damit ein Potenzial für zunehmende Diagnosen vorhanden ist. Ein tatsächlicher Anstieg von ADHS-Diagnosen wurde in 45 Studien beobachtet. Insgesamt 25 Studien zeigten, dass die zusätzlich diagnostizierten Fälle einer leichten Symptomatik zuzuordnen waren. In 83 Studien wurde über den Anstieg der pharmakologischen ADHS-Behandlungen berichtet. Über Ergebnisse einer Diagnose und pharmakologischen Behandlung wurde in 151 Studien berichtet. Nur fünf Studien haben das für und wider einer ADHS-Diagnose/-Behandlung bei leichter Symptomatik abgewogen und gingen auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis innerhalb der zusätzlich diagnostizierten milden Fälle ein.
Fazit
Die Autoren fanden Anhaltspunkte für eine ADHS-Überdiagnose und Überbehandlung bei Kindern und Jugendlichen. Große Forschungslücken wurden festgestellt hinsichtlich der Langzeitfolgen einer ADHS-Diagnose und der pharmakologischen Behandlung von Kindern mit milden Symptomen. Der damit verbundene Schaden könnte einen möglichen Nutzen überwiegen, und Kazda et al. plädieren für mehr Zurückhaltung bei der Diagnose von ADHS bei Kindern, insbesondere in leichten bzw. grenzwertigen Fällen. Weitere Studien sollten durchgeführt werden, um Risiken im Zusammenhang mit einer ADHS-Diagnose/-Behandlung bei Kindern und Jugendlichen mit leichten Symptomen auszuschließen.









