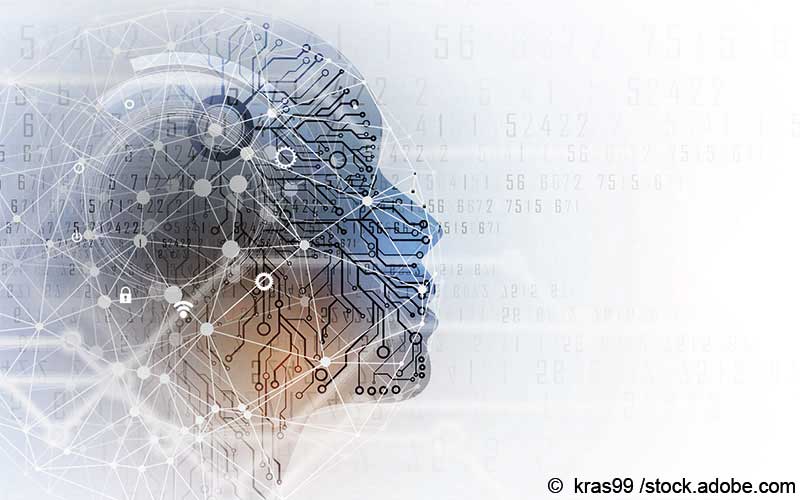
Hintergrund
Eine Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI = Brain-Computer-Interface) ermöglicht es Menschen, über neuronale Signale einen Computer zu kontrollieren. Die Methode basiert auf der Beobachtung, dass bereits die Vorstellung eines Verhaltens messbare Veränderungen in der elektrischen Hirnaktivität auslöst.
Eine BCI besteht aus drei Elementen. Die BCI benötigt zunächst ein Gerät, das die Gehirnaktivität des Menschen aufzeichnet. Dies geschieht meist nicht-invasiv durch die Messung der neuronalen Aktivität mittels EEG (Elektroenzephalografie), die an einen Computer übermittelt wird. Die Signale werden ausgelesen und ausgewertet und über maschinelle Lernsysteme in Steuersignale umgesetzt. Somit kann über die neuronale Aktivität ein Endgerät, beispielsweise ein Sprachprogramm oder ein Rollstuhl, gesteuert werden.
Es ist bekannt, dass intensives körperliches Training Auswirkungen auf die Plastizität des Gehirns hat. „Wir haben uns die Frage gestellt, ob diese Effekte auf die Plastizität des Gehirns auch auftreten, wenn die Aufgabe im Rahmen eines BCI-Versuches rein mental, also nur gedacht, aber nicht körperlich durchgeführt wird“, so Dr. Carmen Vidaurre, Wissenschaftlerin an der Staatlichen Universität von Navarra, die an der aktuellen Studie beteiligt war [1, 2]. Dies könnte neue Optionen bieten, beispielsweise in der Rehabilitationsphase nach einem Schlaganfall.
Zielsetzung
Ob das Training mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle Auswirkungen auf das Gehirn der Probanden hat, untersuchte ein Forscherteam um Dr. Till Nierhaus (Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften Leipzig und TU Berlin) in einer aktuell im Journal of Physiology veröffentlichten Studie [1].
Methodik
Die Studie untersuchte den Einfluss von zwei verschiedenen Arten eines BCIs auf das Gehirn der Studienteilnehmer. Die Probanden hatten keine Vorerfahrungen mit der Technik.
Die Studienteilnehmer wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe erhielt eine Aufgabe zur Beanspruchung des motorischen Systems im Gehirn und sollte sich vorstellen, dass sie ihren Arm oder Fuß bewegt. Die zweite Gruppe sollte ihr visuelles System trainieren und musste Buchstaben auf einem Bildschirm erkennen und auswählen.
Vor und nach den jeweiligen Aufgaben wurde das Gehirn der Probanden mittels struktureller und funktioneller Magnetresonanztomografie untersucht, um mögliche Veränderungen zu detektieren.
Ergebnisse
Es zeigten sich messbare Veränderungen in den Hirnarealen, die für die jeweilige Aufgabe (Ansprache des motorischen oder des visuellen Systems) spezifisch waren. Die Veränderungen traten innerhalb kurzer Zeit, also bereits nach einer Stunde mit dem BCI, auf.
„Noch offen ist dabei die Frage, ob diese Veränderungen auch auftreten würden, wenn die Proband*innen keine Rückkopplung über das BCI-System bekommen würden, dass ihre Hirnsignale erfolgreich ausgelesen werden konnten“, so Nierhaus.
Fazit
Die Studie konnte bei jungen, gesunden Probanden schnelle Effekte auf MRT-Parameter nach der Ausführung von BCI-Aufgaben nachweisen. Die Veränderungen reflektieren sowohl eine strukturelle als auch eine funktionelle Plastizität des Gehirns.
„Gerade die räumliche Spezifität der BCI-Effekte könnte die Möglichkeit eröffnen, zum Beispiel bei Schlaganfallpatient*innen, gezielt die Hirnregionen anzusprechen, die Schaden genommen haben“, so Prof. Dr. Arno Villringer, Direktor der Abteilung Neurologie am MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften.
Weitere Studien seien nötig, um zu untersuchen, wie sich die frühen Effekte des BCI-Trainings langfristig entwickeln und wie die BCI-induzierte Plastizität therapeutisch genutzt werden kann, so die Forscher.










