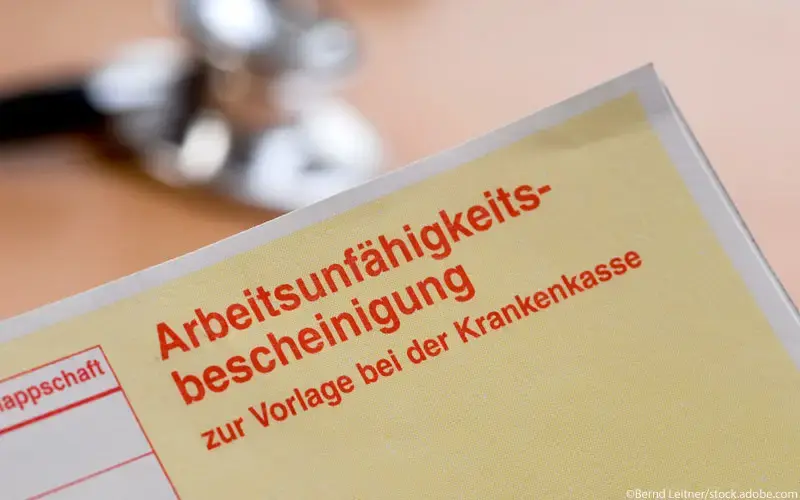
In Deutschland werden immer mehr Beschäftigte wegen Depressionen und anderer psychischer Leiden krankgeschrieben. Die KKH Kaufmännische Krankenkasse mit Sitz in Hannover stuft diesen Trend als Folge der Covid-19-Pandemie ein. Die starken Auswirkungen der Corona-Krise auf die Psyche von Berufstätigen würden sich jetzt in den Statistiken abzeichnen. Während es im ersten und zweiten Coronajahr fast keine Veränderungen gab, sind diese im dritten Krisenjahr umso deutlicher ersichtlich, so die KKH.
In Zahlen registrierte die KKH 2022 bundesweit rund 57.500 Krankschreibungen mit 2,3 Millionen Fehltagen wegen seelischer Probleme. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Anstieg um 16%. Die meisten PatientInnen seien aus der Krankenpflege sowie der Erziehung und Sozialarbeit, schreibt die Kasse [1].
Häufigste Diagnose: depressive Episoden
Am häufigsten wurden depressive Episoden diagnostiziert. Mit einem Anteil von 30% machte diese Diagnose die Mehrheit der Ausfalltage bei den psychischen Erkrankungen aus. Mit 28% lagen depressive Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen knapp dahinter. Fast 15% der Krankheitstage ging laut KKH auf wiederkehrende Depressionen, gut 12% auf chronische Erschöpfung und rund 8% auf Angststörungen zurück. In 7% waren somatoforme Störungen die Ursache des Arbeitsausfalls.
Immer mehr Männer betroffen
Die Folgen der Coronapandemie scheinen insbesondere Männer zu belasten. Auch wenn immer noch deutlich mehr Frauen von psychischen Erkrankungen betroffen sind, holen die Männer auf. Bei sämtlichen Diagnosen sei hier ein deutlich größerer Anstieg zu verzeichnen als bei den weiblichen Patientinnen, gerade mit Blick auf Angststörungen und somatoforme Störungen, so die Kasse.
2022 erhielt die KKH aufgrund von Angststörungen rund 40% mehr Atteste von männlichen Arbeitnehmern als im Jahr zuvor. Bei Frauen war das Plus mit 19% deutlich geringer. Bei den somatoformen Störungen gab es eine noch größere Differenz: Ein Plus von rund 6% bei Frauen stand einem Anstieg von fast 22% bei den Männern gegenüber.
Insgesamt liegt der Anteil der Männer mit psychischen Erkrankungen jetzt bei fast 34% – im ersten Corona-Jahr 2020 waren es noch 31%.
Bewegungsmangel und fehlender sozialer Austausch ausschlaggebend
Nach Einschätzung der KKH-Arbeitspsychologin Antje Judick sind viele Männer, die vorher im Vereins- und Mannschaftssport eingebunden waren, deutlich weniger körperlich aktiv als vor der Pandemie. „Der dadurch entstandene Bewegungsmangel und der fehlende soziale Austausch scheinen sich nachhaltig negativ auf die Psyche, also auf Antrieb und Motivation und die allgemeine Stimmungslage ausgewirkt zu haben“, erklärt die Psychologin.
Pandemie, Inflation und Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt belasten Männer stärker
Neben der Pandemie müssen weitere Veränderungen in Betracht gezogen werden, etwa die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs, insbesondere die Inflation, und die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt. „Da sich Männer häufig mehr Sorgen um ihre Perspektiven im Job und die wirtschaftliche Situation ihrer Familie machen als Frauen, leiden sie möglicherweise besonders stark unter Existenzängsten“, sagt Judick.
Bei den Frauen ist es meist der Spagat zwischen Job, Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen, der als psychisch belastend empfunden wird. Dieses Problem habe es bereits vor Corona gegeben, die Pandemie habe es nur noch verschärft.
Da bei Frauen allerdings bereits seit Jahren deutlich häufiger psychische Erkrankungen diagnostiziert werden, zeichnet sich der erneute Anstieg nicht so dramatisch ab wie bei den Männern. „Dass die Männer nun so stark aufholen, zeigt, dass sie einen sehr hohen Leidensdruck haben“, erläutert die KKH-Expertin.










