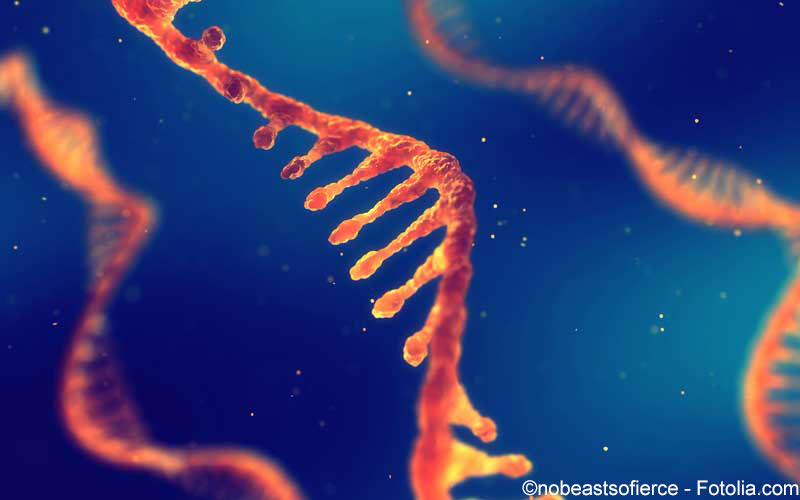
Hintergrund
Heutzutage haben Gentests auf DNA-Ebene Einzug in die klinische Praxis gefunden. Die Identifizierung einer erblichen Veranlagung für diverse Krebsarten ist möglich und öffnete die Tür zur personalisierten Medizin, wodurch die Krebs-assoziierte Morbidität und Mortalität sank. Die Interpretation der durch die Gentests auf DNA-Ebene gewonnen Daten bleibt aber bis heute eine Herausforderung.
Man schätzt, dass bei ca. 15% bis 25% der DNA-Varianten, die mit erblich bedingtem Krebs assoziiert sind, das Spleißen der Gene die funktionale RNA zerstört. Diese RNA-Sequenzen definiert man aufgrund der fehlenden Funktionalität als Varianten von unklarer Signifikanz (VUS).
Zielsetzung
Das Ziel der Studie war es herauszufinden, ob die Durchführung von Gentests auf RNA-Ebene zusätzlich zu Gentests auf DNA-Ebene die Diagnostik verbessert und damit das personalisierte Krebsrisiko-Management der Patienten mit erblichen Veranlagungen zu diversen Krebsarten.
Methodik
Für die diagnostische Studie waren Patienten oder deren Familienangehörige geeignet, wenn bei ihren Gentests auf DNA-Ebene uneindeutige Ergebnisse in Bezug auf Gene des erblich bedingten Brust- oder Eierstockkrebs, des Lynch-Syndroms oder dem hereditären diffusen Magenkarzinom aufgetreten sind. Von diesen Patienten wurde mittels einer Blutprobe ein Gentest auf RNA-Ebene durchgeführt.
Letztendlich in die Studie eingeschlossen, wurden Patienten oder deren Familienangehörige bei denen im Gentest auf RNA-Ebene Mutationen in Genen der Keimbahn identifiziert wurden. Untersucht wurde dann, ob sich durch die zusätzlichen Erkenntnisse auf RNA-Ebene das klinische Management bei den Patienten bzw. den Familien geändert hat. Zur Beantwortung dieses Ansatzes mussten die behandelnden Ärzte an einer anonymen Umfrage teilnehmen.
Für die Bestimmung der Anzahl an Patienten, die von einem Gentest auf RNA-Ebene profitieren, wurde eine zusätzliche Patientenkohorte untersucht. Bei dieser wurde ein Gentest auf DNA-Ebene für die erbliche Veranlagung von Krebs durchgeführt und Genvarianten identifiziert, bei denen man davon ausgeht, dass sie das Spleißen der RNA beeinflussen.
Ergebnisse
Interpretation der Ergebnisse und Auswirkungen auf das klinische Management
Von insgesamt 909 geeigneten Familien nahmen 93 Familien (10,2%) an einem Gentest auf RNA-Ebene teil. Die in dem Gentest gewonnen Daten halfen in 49 von 56 unklaren Fällen (88%) eine eindeutige Aussage zu treffen. Bei insgesamt 26 Fällen (47%) lagen nun verwertbare Informationen vor und 23 Fälle (41%) wurden als gutartig reklassifiziert. Basierend auf 18 von 45 Umfragen (40%) der Kliniker zeigte sich, dass durch die Reklassifizierung bei 8 der 18 Patienten (44%) das klinische Management angepasst wurde sowie bei insgesamt 14 der 18 Familien.
Häufigkeit des veränderten RNA-Spleißens in einer Testkohorte
Die untersuchte Patientenkohorte bestand aus Daten von 307.812 Patienten. Bei 7.265 Patienten, die sich einem Gentest auf DNA-Basis unterzogen haben, konnten pathogene Varianten oder Varianten mit einer unklaren Signifikanz nachgewiesen werden die potenziell das Spleißen der RNA beeinflussen. Somit kann man davon ausgehen, dass ungefähr jeder 43. Patient oder Familienangehörige von einem Gentest auf RNA-Basis profitiert. Diese Berechnung basiert auf der Annahme, dass sich jeder einer genetischen Bestimmung auf erblich bedingten Krebs unterzieht.
Fazit
Die in dieser Studie durchgeführten Gentests auf RNA-Basis konnten zunächst viele VUS in einer Kohorte von Patienten und Familienangehörigen, die sich auf erbliche Veranlagungen für Krebs untersuchen ließen, identifizieren und charakterisieren. Zusätzlich zeigte sich, dass durch die in dem Gentest auf RNA-Basis gewonnen Daten, jedem 43. Patienten helfen würden, da sich mit den gewonnen Erkenntnissen das diagnostische Outcome verändert.













