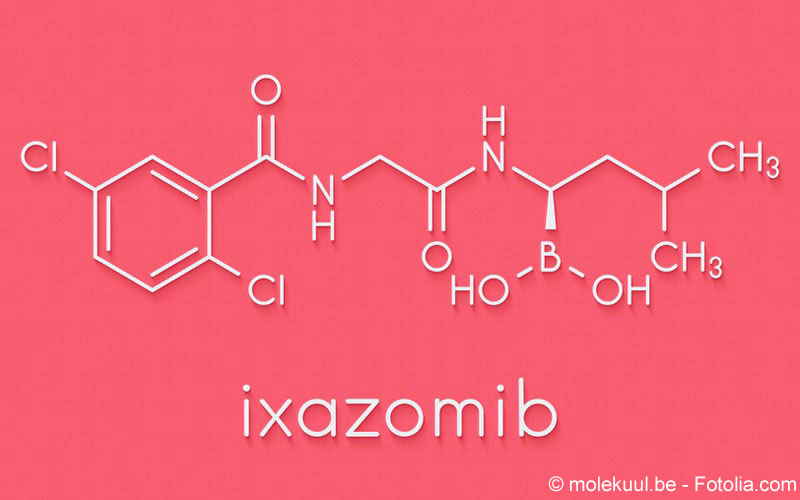
Die Phase-3-Studie TOURMALINE-MM3 vergleicht eine Erhaltungstherapie mit Ixazomib und Placebo auf das progressionsfreie Überleben von 656 erwachsenen Patienten mit Multiplem Myelom (MM), die auf eine Induktionstherapie mit anschließender Hochdosistherapie und autologer Stammzelltransplantation (ASCT) angesprochen haben.
Studienaufbau
Im Verhältnis 3:2 erhielten die Patienten randomisiert und doppelblind entweder Ixazomib (Zyklen 1–3: 3 mg; Zyklen 5-26: 4 mg) oder Placebo jeweils an den Tagen 1, 8 und 15 jedes 28-tägigen Zyklus. Etwa ein Drittel der Patienten in beiden Studienarmen wies einen leicht oder stärker eingeschränkten Gesundheitszustand auf (ECOG Performance Status 1 oder 2). Ebenfalls ein Drittel der Patienten in beiden Gruppen war zum Zeitpunkt der Randomisierung frei von einer messbaren minimalen Resterkrankung (MRD). Der primäre Endpunkt war das progressionsfreie Überleben (PFS), beurteilt durch ein unabhängiges Gutachtergremium, das für die Studienmedikation verblindet war.
39% verbessertes PFS
Nach median 31 Monaten zeigte sich bei Ixazomib-Erhaltungstherapie eine 28%ige Reduktion des Risikos für Progress oder Tod gegenüber Placebo (Hazard Ratio 0,72; 95% Konfidenzintervall 0,58– 0,89; p=0,002). Das PFS lag bei Ixazomib-Erhaltungstherapie bei median 26,5 Monaten, in der Placebogruppe bei 21,3 Monaten. Dies entspricht einer 39%igen Verbesserung, betonte Dimopoulos.
Das mediane Gesamtüberleben war zum Zeitpunkt der vorgestellten Analyse in beiden Studienarmen noch nicht erreicht. Zahlreiche untersuchte Subgruppen profitierten von der Therapie gleichermaßen. Dimopoulos hob besonders hervor, dass dies auch für die 60- bis 75-jährigen Patienten galt, für Patienten mit Standardrisiko ebenso wie mit hohem zytogenetischen Risiko und auch für Patienten mit einer Erkrankung des Stadiums 3 nach dem Internationalen Staging-System (ISS). Der PFS-Vorteil war auch unabhängig davon, ob Patienten bereits zu Studienbeginn MRD-negativ gewesen waren oder nicht. Das Ansprechen vertiefte sich durch die Erhaltungstherapie weiter. Eine MRD-Positivität bei Studieneintritt wandelte sich unter Ixazomib bei 12% und in der Placebogruppe bei 7% in eine MRD-Negativität um.
Therapie wurde gut toleriert
Der Anteil an Patienten, die die Studienmedikation wegen Nebenwirkungen abbrachen, war mit 7% im Ixazomib- und 5% im Placeboarm gering. Nebenwirkungen des Grads 3 und höher traten bei 42% der mit dem Proteasom-Inhibitor behandelten Patienten und bei 26% der Patienten im Placeboarm auf, schwere Nebenwirkungen bei 27% und 20% der entsprechenden Gruppen.
Häufige Nebenwirkungen waren Infektionen (15% vs. 8%), gastrointestinale Erkrankungen (6% vs. 1%) Neutropenien (5% vs. 3%) und Thrombozytopenien (5% vs. 1%). Die Rate peripherer Neuropathien lag bei Ixazomib-Therapie mit 19% kaum über der im Placeboarm mit 15%, einen Grad 3 erreichten diese Nebenwirkungen praktisch nie (<1% vs. 0%). Die Lebensqualität nach dem Instrument EORTC QLQ-C30 war bei Ixazomib-Therapie vergleichbar wie im Placeboarm.













