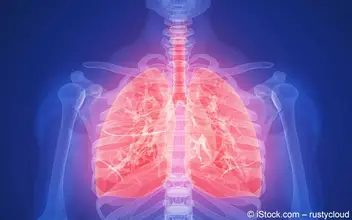70% der Lungenkrebs-Patienten erhalten die Diagnose im Stadium eines unheilbaren Bronchialkarzinoms. Mit dem Screening könnte dieser Anteil deutlich verringert werden, ist Prof. Dr. Felix J. F. Herth, Chefarzt der Abteilung für Pneumologie und Beatmungsmedizin der Thoraxklinik der Universität Heidelberg, überzeugt [1]. Schon drei randomisiert-kontrollierte Studien haben gezeigt, dass ein Lungenkrebs-Screening die krankheitsspezifische Mortalität reduziert [2–4].
Problem Rundherde
Problematisch macht das Screening allerdings die schwierige Unterscheidung zwischen benignen und malignen Befunden. Die Screening-Zielpopulation der Raucher weist sehr häufig Rundherde auf, die aber meist gutartig sind. Dadurch gibt es in den Studien eine hohe Falsch-positiv-Rate, die in der US-amerikanischen NLST-Studie bei 96,4% lag. Die Berücksichtigung der Volumenverdopplungszeit der Herde kann die Falsch-positiv-Rate etwas verbessern. In der holländischen NELSON-Studie lag aber auch dann die Falsch-positiv-Rate noch bei 60% [2, 3].
Qualitätssicherung von großer Bedeutung
Daraus müssen hohe Anforderungen an die Qualitätssicherung beim Screening abgeleitet werden, erklärte Herth. Das Problem der Strahlenbelastung bei wiederholter Computertomographie lässt sich dagegen durch neue Protokolle wesentlich verringern; pro Untersuchung liegt sie im Mittel bei 0,135 mSv. Die Deutsche Röntgengesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin haben sich gemeinsam für die Einführung eines Niedrig-Dosis-CT im Rahmen eines qualitätsgesicherten Früherkennungsprogramms ausgesprochen [5].
Screening für wen?
Die Einschlusskriterien in den randomisiert-kontrollierten Studien waren unterschiedlich. Es gibt noch keinen Konsens, ab welchem Alter und welcher Rauchintensität das Screening idealerweise angeboten werden sollte. Herth nannte ein Alter über 50 Jahre und einen Konsum von mehr als 20 Packungsjahren als mögliche Kriterien, betonte aber, es sei schwer vorauszusagen, wie die Entscheidung letztlich fallen wird. Er geht davon aus, dass weitere potenzielle Risikofaktoren mit in die Definition der Zielpopulation einbezogen werden. In Studien waren das beispielsweise der Body-Mass-Index, chronisch obstruktive Atemwegserkrankung (COPD) oder familiäre Krebserkrankungen.
G-BA muss über Screening entscheiden
Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit hat in seinem Abschlussbericht im Oktober 2020 ein positives Signal für die Einführung des Lungenkrebsscreenings in Deutschland gegeben. Derzeit steht noch das endgültige Votum des Bundesamts für Strahlenschutz aus. Anschließend trifft der Gemeinsame Bundesausschuss innerhalb von 18 Monaten seine Entscheidung. Herth forderte die Durchführung nur an von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifizierten interdisziplinären Lungenkrebszentren und eine standardisierte Auswertung durch zertifizierte Radiologen inklusive Software. Wichtig ist eine klare Definition „positiver Befunde“ und der Abklärungsalgorithmen. Auch sollte es standardisierte interdisziplinäre Kommunikations- und Versorgungsstrukturen geben und die Implementierung durch ein zentrales Register wissenschaftlich begleitet werden.
Prävention inklusive
Die Zentren müssten seiner Ansicht nach auch Maßnahmen zur Raucherentwöhnung anbieten. Er forderte n diesem Zusammenhang, endlich die Raucherentwöhnungs-Maßnahmen nicht mehr als „Life Style“ anzusehen, sondern in die Kostenerstattung aufzunehmen. Zudem plädierte er dafür, dass sich die Lungenkrebs-Screeningzentren auch in der Primärprävention engagieren: Ziel muss es letztlich sein, den Einstieg in den Tabakkonsum überhaupt zu verhindern.