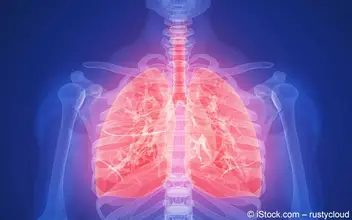Hintergrund
In den vergangenen Monaten zeigte sich immer deutlicher, dass COVID-19 mit dem Überstehen der akuten Phase der Erkrankung für einen Teil der Patienten nicht ausgestanden ist. „Vielmehr leiden viele COVID-19 Betroffenen, die in den Statistiken als Genesene verzeichnet werden, noch Wochen und Monate unter einer zum Teil massiven Einschränkung physischer, funktioneller und emotionaler Funktionen“ erklärte Professor Dr. Ioannis Vogiatzis Lehrbeauftragter für Sport, Bewegung und Rehabilitation von der Northumbria Universität Newcastle in seinem Vortrag im der Rahmen der Session: „Post-COVID 19“ auf dem virtuellen ERS Kongress 2020. [1]
Post-COVID-19 Symptome
„Die fortbestehenden Symptome bei einem Teil der COVID-19 Patienten nach der Krankhausentlassung sind so vielfältig wie in der akuten Phase der Erkrankung“, erläuterte Professor Dr. Sally J. Singh, Leiterin der pulmonalen und kardialen Rehabilitation an den Universitätskliniken in Leicester und Lehrbeauftragte an den Universitäten Leicester und Coventry. Die weitaus häufigsten Beschwerden sind Fatigue und Atemlosigkeit. Die Patienten klagen auch über Gelenk- und Brustschmerzen sowie Funktionsstörungen von Seh-, Geruchs- und Geschmack. Husten und Nasenausfluss treten seltener auf als in der akuten Phase. Weiterhin berichten die Patienten über trockene Schleimhäute, gerötete Augen, Kopfschmerzen, Sputum, Appetitmangel, Halsschmerzen, Schwindel, Muskelschmerzen und Diarrhoe. [2]
Physische und psychische Folgen
Bei Patienten mit fortbestehenden Beschwerden zeigen sich in entsprechenden Tests auch deutliche Einschränkungen der physischen Leistungsfähigkeit, sowie funktionelle Einschränkungen wie zum Beispiel der Lungenfunktion (s.u.). Die psychischen Folgen der Erkrankung können gravierend sein. „Insbesondere die schwererkrankten Patienten leiden unter den Symptomen einer Posttraumatischen Belastungsstörung mit Depressionen und Angststörungen“, sagte Singh. Eine Task Force der ERS hat ausführliche, wenn auch vorläufige, Empfehlungen zur Rehabilitation nach COVID-19 zusammengestellt. Die Empfehlungen wurden auf der Grundlage einer Expertenbefragung erarbeitet und als Fachartikel im European Respiratory Journal veröffentlicht. [3]
Pfad zur strukturierten Nachsorge
Zur strukturierten Nachsorge für COVID-19 Patienten empfahlen Vogiatzis und Singh den vorläufigen Versorgungspfad der British Thoracic Society. [4] Der Versorgungspfad wurde auf der Basis einer Umfrage unter 1031 Experten erstellt und wird mit zunehmender Evidenz weiterentwickelt werden. Der Versorgungspfad unterscheidet zwei Phasen die ersten 6-8 Wochen nach der Entlassung und die darauf folgenden 6-8 Wochen.
Phasen der Nachsorge in Kürze
Bei der Krankenhausentlassung sollte der Patienten einem Post-COVID Rehabilitationsteam vorgestellt werden, das Empfehlungen zur individuellen Rehabilitation nach Beschwerden und Schweregrad der Symptome erarbeitet. Das Team hält telefonischen Kontakt zum Patienten, um das Patientenbefinden und den Rehabilitationsbedarf laufend zu überprüfen. Nach der ersten Phase findet ein erneutes Assessment der Patienten statt, auf dessen Grundlage die Empfehlungen zur Rehabilitation in der folgenden Phase angepasst werden. Am Ende der zweiten Phase wird der Patient erneut umfassend untersucht und das langfristige Vorgehen mit ihm vereinbart.
Telerehabilitation
Vogiatzis plädierte für eine intensive Nutzung der Telekommunikation auch in der Rehabilitation. Vorausgesetzt, dass sowohl das medizinische Personal als auch die Patienten sorgfältig in die Techniken der Telekommunikation geschult sind, stellt die Telerehabilitation zu Zeiten von Social Distancing eine sehr gute Möglichkeit der strukturierten Nachsorge dar, so Vogiatzis. „Moderne Techniken erlauben ein zuverlässiges Telemonitoring und eine persönliche Betreuung. Dabei sind sie ressourcenschonend, wetterunabhängig und ersparen dem Patienten Anfahrten, “ erklärte Vogiatzis.
Lungenfibrosen infolge von COVID-19-Pneumonien
Neben funktionellen Einschränkungen werden auch zunehmend strukturelle Veränderungen an Organen durch COVID-19 registriert, deren Spätfolgen noch nicht absehbar sind. Professor Dr. Francesco Blasi von der Universität Mailand, ehemaliger Präsident der ERS und Leiter der Abteilung Innere Medizin IRCCS Fondazione Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico fokussierte in seinem Vortrag auf Veränderungen in der Lunge.[5]
Bereits zu Beginn der SARS-CoV-2-Pandemie in China wurde beobachtet, dass sich nach einer COVID-19-Pneumomie Fibrosierungen in den gleichen Lungenregionen entwickeln können, in denen zuvor Milchglaseintrübungen im CT erkennbar waren. Molekularbiologische Untersuchungen zeigen darüber hinaus auf, dass SARS-CoV-2 transkriptionale Signaturen in humanen Lungenepithelien induziert, die auch bei Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose (IPF) besonders aktiv sind.
„Die Prävalenz von post-COVID-19-Fibrosen wird erst mit der Zeit offenbar werden. Frühe Analysen weisen jedoch darauf hin, dass rund ein Drittel der COVID-19 Patienten fibrotische Veränderungen entwickeln könnten. Darüber hinaus weisen 47% der Patienten eine eingeschränkte Kohlenmonoxid-Diffusionskapazität (Diffusing Capacity of the lungs for carbon monoxide [DLCO]) und 25% eine verringerte Totalkapazität( total lung capacity [TLC)] auf,“ erklärte Blasi.
Zur Behandlung der fibrotischen Veränderungen infolge von COVID-19-Pneumonien kursieren derzeit eine Vielzahl von Therapieansätzen. Keiner dieser Ansätze sei evidenzbasiert, so Blasi. An seiner Klinik habe man jedoch gute Erfahrungen mit Steroiden gemacht, antwortete Blasi auf eine Frage nach einer Therapieempfehlung in der dem Vortrag folgenden Diskussionsrunde. Ob die Fibrosierungen infolge der COVID-19-Pneumonie im Laufe der Zeit weiter fortschreiten, könne man heute noch nicht sagen, führte Blasi weiter aus. Er persönlich sei jedoch verhalten optimistisch, weil sich die Lungenfibrosen seiner Erfahrung nach als steroidresponsiv erwiesen hätten.