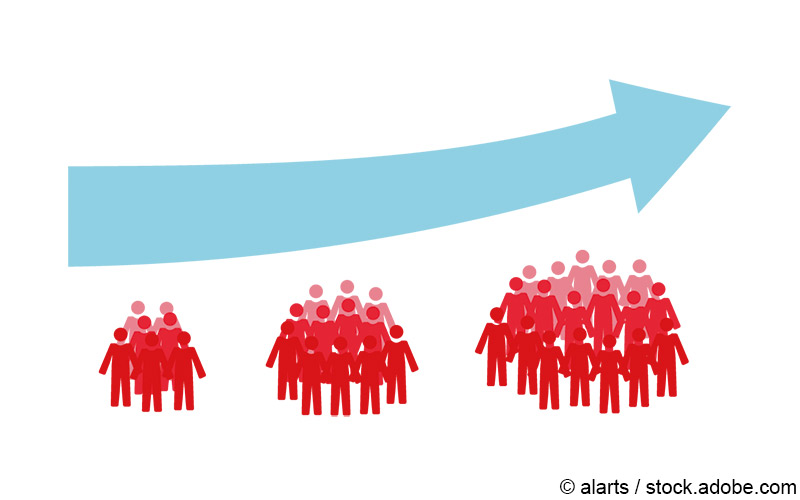
Diabetes mellitus zählt zu den sogenannten sechs großen Volkskrankheiten bzw. Krankheitskomplexen in Deutschland. Nicht selten reduziert er die Lebensqualität der Betroffenen und führt zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Besonders im Hinblick auf das steigende Lebensalter wird dieser Aspekt in den nächsten Jahrzehnten immer relevanter werden. Ähnliches reflektieren auch die Mortalitätsraten. Sie sinken zwar international - inklusive Deutschlands, die bisher angenommenen diabetesassoziierten Sterberaten sind aber wahrscheinlich deutlich höher als vermutet und mit etwa 16% aller Todesfälle zählen diabetesassoziierte Sterbefälle zu den Häufigen.
Unterschieden wird bei Diabetes mellitus zwischen Typ 1, bei dem ein absoluter Mangel an Insulin vorliegt, und Typ 2, bei dem eine vererbte oder erworbene Insulinresistenz und eine qualitative und quantitative Insulinsekretionsstörung besteht.
Diabetes - eine Volkskrankheit
In Deutschland ist etwa jeder zehnte von Diabetes mellitus betroffen. In absoluten Zahlen waren das 2015 etwa sieben Millionen Menschen mit Typ 2 und 32.000 Kinder und Jugendliche sowie 341.000 Erwachsene mit Typ 1. Für 2020 prognostiziert der Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2021 bereits acht Millionen Typ 2-Diabetikerinnen und -Diabetiker und eine Dunkelziffer von etwa zwei Millionen. Tendenz aufgrund der zunehmenden Prävalenz weiter steigend. Bis zum Jahr 2040 werden es vermutlich bereist 11,5 Millionen Menschen in Deutschland sein.
Höhere Dunkelziffer
Die Dunkelziffer der Erkrankung wird anhand des HbA1c - dem Langzeitdiabeteswert - geschätzt. Genaue Zahlen können laut Bericht nicht angegeben werden, da nur Zahlen aus den Daten der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) verwendet werden können. Die privaten Krankenkassen sind in den Analysen nicht enthalten. Insgesamt ist die Dunkelziffer seit 1997 aber vermutlich deutlich gesunken. Als Gründe gibt der Deutsche Gesundheitsbericht Diabetes 2021 verbesserte Screenings bei Risikopersonen, die HbA1c-Diabetesdiagnostik und die steigende Nutzung von Diabetesrisikoscores an.
Diabetes im Zeichen von Sars-CoV-2
Wie bei vielen Erkrankungen hat sich die aktuelle pandemische Lage auch bei Diabetes mellitus Patientinnen und Patienten bemerkbar gemacht. Aus Sorge, sich anstecken zu können, blieben viele wichtigen und notwendigen Kontrollterminen fern. Auch bei schwerwiegenden Problemen scheuten einige den Arztbesuch. Diese Sorge ist nicht verwunderlich, denn das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf ist bei Diabetespatientinnen und -patienten erhöht, ebenso das Sterberisiko.
Ein weiteres Problem während der Shutdowns in Deutschland war, dass in vielen pädiatrischen Diabetesambulanzen nur eingeschränkt Patientinnen und Patienten gesehen werden konnten. Telemedizinische und telefonische Lösungen sind nicht für alle Familien gut zugänglich. Erschwerend kamen veränderte Tagesstrukturen, fehlender Alltag und geänderte Lebensrhythmen hinzu, die eine Stoffwechseleinstellung negativ beeinflussen können. Im Zeitraum zwischen Mitte März und Mai 2020 stieg der Anteil der Kinder- und Jugendlichen mit diabetischer Ketoazidose bei Typ-1-Neumanifestation sichtbar an. Typ 1 ist der vorrangige Diabetes mellitus-Typ bei Kindern und Jugendlichen.
Altersverteilung
Im Mittel wird bei Menschen im Alter von 61 Jahren bei Männern und 63 Jahren bei Frauen ein Typ-2-Diabetes diagnostiziert. Pro Jahr sind es etwa 600.000 Neuerkrankungen bei einer Inzidenzrate von 12 pro 1.000 im Jahr 2012. Bei Minderjährigen mit Typ-1-Diabetes liegt die Inzidenz etwa bei 23,6 pro 100.000 Personenjahren. Das sind auf das Jahr gerechnet 3.100 Neuerkrankungen. Bis Ende 2026 soll sie um 0,27% steigen. Dann würden 3 von 1.000 Kindern an Diabetes Typ 1 erkrankt sein und die Zahlen sich innerhalb von 20 Jahren verdoppelt haben.
Höheres Risiko in den neuen Bundesländern
Die Erkrankungsraten sind jedoch nicht gleichmäßig über Deutschland verteilt. Während besonders Schleswig-Holstein und Hamburg niedrige Prävalenzen haben (7,9% und 7,3%), liegen sie mit mehr als 13% in den neuen Bundesländern und 11% im Saarland deutlich höher. Das liegt jedoch nicht, wie vielleicht zunächst vermutet würde, am sozioökonomischen Individualstatus der dort lebenden Menschen. Vielmehr ist die Odds Ratio in Gemeinden mit höchster struktureller Benachteiligung doppelt so hoch und das vermutlich der entscheidende Faktor für den Diabetes mellitus Typ 2. Auch das Stadtleben scheint das Risiko für Typ-2-Diabetes zu erhöhen - und das um etwa 40%.
Prävention statt Rehabilitation
Gerade deshalb spielen die Diabetesprophylaxe und -prävention von Folgeerkrankungen im medizinischen Alltag eine große Rolle, denn manche Faktoren sind vermeidbar. Insbesondere bezogen auf den Typ 2-Diabetes.
Lifestyleänderung nicht immer erfolgreich
Patientinnen und Patienten wird empfohlen, sich mehr zu bewegen und abzunehmen, da dies als Prävention für Typ-2-Diabetes angesehen wird. Das funktioniert jedoch nur bedingt. „Wenn die Prävention immer erfolgreich wäre, würden wir es nicht mit einer noch immer wachsenden Diabetespandemie zu tun haben“, schreibt Andreas Fritsche von der Medizinischen Universitätsklinik Tübingen.
Risikostratifizierte Prävention sinnvoll
Sinnvoll wäre, eine risikostratifizierte Prävention über Subphänotypen. Dadurch könnten die Patientinnen und Patienten definiert werden, die ein hohes oder niedriges Diabetesrisiko haben. Das würde allerdings auch voraussetzen, dass Hochrisikopatienten anschließend eine ausreichende präventive Versorgung bekämen. Auch würde dazu gehören, dass, wie Professorin Diana Rubin vom Viavantes Klinikum Spandau fordert, leitliniengerechte multimodale Gewichtsprogramme in den Regelleistungskatalog der GKV aufgenommen werden.
Ein Fokus liegt dabei auf der Bewegung. Bewegungsfreundliche Umgebungen können beispielsweise helfen, das individuelle Risiko zu reduzieren. Ebenfalls spielen Grünflächen in Städten eine relevante Rolle, sowie die „Walkability“ von Alltagsdingen oder Lärm und verkehrsbedingte Luftschadstoffe. „Für einen Einstieg [in die Prävention] ist es (…) nie zu spät“, schreiben die Experten dazu im Bericht - vor allem in Hinblick auf mehr Bewegung im Alltag.









