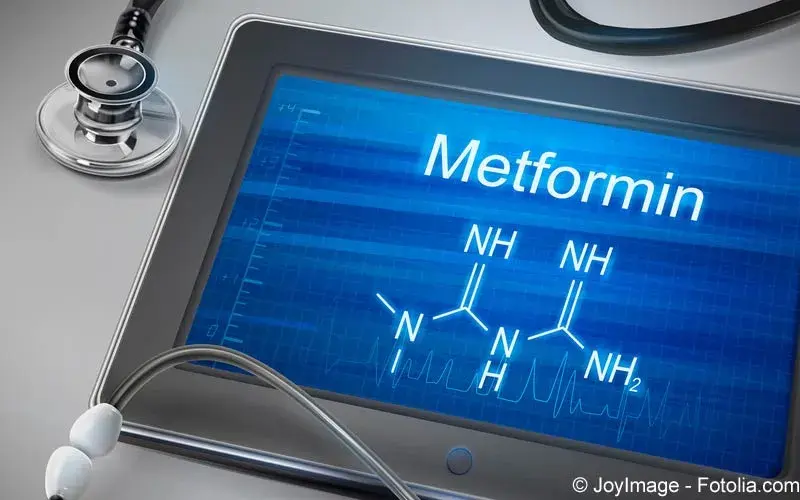
Hintergrund
Im Zuge einer alternden Gesellschaft tritt auch ein Delir häufig auf. Ein Delir ist eine akute Wesensänderung im Rahmen einer schweren Akuterkrankung und geht mit einer Unordnung der Wahrnehmung und Gedanken sowie einem selbstgefährdenden Bewegungsdrang einher [1]. Ein Delir ist unter Umständen mit längerer Hospitalisierung, poststationärer Pflegebedürftigkeit und hoher Mortalität verbunden.
Das Risiko eines Delirs steigt mit dem Alter, aber auch bei Erkrankungen wie Infektionen, zum Beispiel COVID-19, und nach Operationen. Derzeit ist die Pathogenese des Delirs nicht ausreichend verstanden und es existieren keine therapeutischen oder präventiven Methoden, um die Versorgung von Patienten mit Delir effektiv zu verbessern. Untersuchungen zur Entdeckung neuer Behandlungsansätze für diese verheerende Krankheit sind daher gerechtfertigt.
Ein weiterer Hauptrisikofaktor für das Auftreten eines Delirs ist die Demenz. Mit einem beschleunigten kognitiven Verfall und einem erhöhten Risiko für Demenz wurden Diabetes mellitus und hohe Glukosespiegel in Verbindung gebracht. Dies deutet darauf hin, dass vaskuläre und zelluläre Schäden, die durch hohen Blutzucker induziert werden, pathologische Prozesse vermitteln können, die auch zum Beginn und zur Progression von Demenz führen.
Es ist denkbar, dass Diabetes mellitus durch gemeinsame zugrundeliegende Mechanismen, die das Demenzrisiko erhöhen, auch das Risiko eines Delirs erhöht. In der Literatur finden sich jedoch hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Diabetes und Delir trotz des engen Zusammenhangs zwischen Delir und Demenz keine konsistenten Informationen.
Es wurde berichtet, dass das Antidiabetikum Metformin altersbedingte Störungen, einschließlich Demenz, verbessert und die Mortalität senkt. Andere Antidiabetika zeigten diesen Effekt weniger ausgeprägt. Bisher existieren nur sehr begrenzte Daten über die mögliche Rolle von Metformin und seine Assoziation mit Delirium, Mortalität und Diabetes.
Zielsetzung
Wissenschaftler untersuchten daher im Rahmen einer retrospektiven Studie, ob die Einnahme von Metformin in der Anamnese mit einem geringeren Risiko für ein Delir verbunden ist und ob es die Mortalität senken kann. Japanische und US-amerikanische Wissenschaftler um Erstautor Dr. Takehiko Yamanashi, der an der Stanford University School of Medicine, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences in Palo Alto, am University of Iowa Carver College of Medicine, Department of Psychiatry in Iowa City in den USA und an der Tottori University Faculty of Medicine, Department of Neuropsychiatry in Yonago-Shi in Japan forscht, veröffentlichten die Ergebnisse ihrer Analysen im Fachblatt Aging [2].
Methodik
In dieser retrospektiven Kohortenstudie wurden Daten von zuvor für eine anderer Studie ausgewählten 1.404 Probanden mit und ohne Delir analysiert. Die Studienteilnehmer waren zwischen Januar 2016 und März 2017 an einer medizinischen Einrichtung der University of Iowa entweder stationär aufgenommen worden oder hatten die Notaufnahme besucht.
Die Wissenschaftler entnahmen den elektronischen Patientenakten detaillierte Informationen über die Vorgeschichte der Metformin- und Insulinanwendung und teilten die Patienten entsprechend in eine Gruppe mit Metforminanwendung und eine Gruppe ohne Metforminanwendung vor dem Zeitpunkt der Aufnahme in die Studie ein. Daten von Patienten mit Diabetes mellitus vom Typ 1 sowie mit Schwangerschaftsdiabetes wurden nicht berücksichtigt. Auch der Body Mass Index (BMI) wurde erfasst.
Als Instrumenten zur Deliriumsbewertung verwendeten die Forscher die Confusion Assessment Method for Intensive Care Unit (CAM-ICU), die Delirium Observation Screening Scale (DOSS) und die Delirium Rating Scale – Revised-98 (DRS-R-98). Die CAM-ICU und DRS kamen zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Studie zum Einsatz.
Den DOSS-Score erfasste das Pflegepersonal im Rahmen der Patientenversorgung in der Patientenakte. Die Patienten wurden als Delir-positiv eingestuft, wenn die Bewertung nach CAM-ICU positiv war, die Werte in der DRS-R-98 ≥19 oder in der DOSS ≥3 waren, oder wenn sich in der Krankenakte ein Hinweis auf Verwirrung oder das Vorliegen eines Delirs fand. Die Gesamtmortalität der Studienteilnehmer ermittelten die Wissenschaftler aus einer Überprüfung von Krankenakten und Todesanzeigen.
Die Wissenschaftler untersuchten den Zusammenhang zwischen einer früheren Metformineinnahme und Delir sowie den zwischen einer frühere Metformineinnahme und der Dreijahres-Mortalität. Sie verglichen die Prävalenz des Delirs in der Gruppe ohne Diabetes mellitus Typ 2 (DM), der DM-mit-Metformin-Gruppe und der DM-ohne-Metformin-Gruppe mithilfe des Chi-Quadrat-Tests. Die Beziehung zwischen Delir und Metformineinnahme in der DM-Gruppe testeten sie mittels logistischer Regressionsanalyse, in der Kovariablen wie Alter, Geschlecht, BMI, Insulinanwendung und Demenzstatus berücksichtigt wurden.
Darüber führten die Wissenschaftler zusätzliche logistische Regressionsanalysen separat für die Probanden mit Demenz und Probanden ohne Demenz durch. Als Kovariablen wurden Alter, Geschlecht, der Charlson Comorbidity Index (CCI), der BMI und die Insulinanwendung berücksichtigt. Die Mortalität wurde mithilfe von Kaplan-Meier-Überlebenskurven analysiert. Log-Rank-Statistiken wurden verwendet, um die Signifikanz von Unterschieden in der Dreijahres-Mortalität zu bewerten.
Hazard Ratios (HRs) für den Tod bis zu drei Jahre nach Aufnahme in die Studie ermittelten die Wissenschaftler mittels proportionaler Cox-Hazard-Regressionsmodelle, in denen sie wiederum das Alter, das Geschlecht, den CCI, den BMI sowie die Insulin- und die Metformineinnahme bei Probanden mit DM berücksichtigten. Um geeignete Gruppen von Metforminanwendern und Nicht-Anwendern zu erstellen, wendeten die Wissenschaftler die Propensity-Scores-Methode an.
Ergebnisse
Das Durchschnittsalter der Patienten betrug 68,6 Jahre (Standardabweichung [SD] = 13,6 Jahre). 48,7% der Patienten waren Frauen und 95,7% waren Weiße mit nicht-hispanischen Hintergrund. Bei 898 Patienten war keine Erkrankung mit Diabetes mellitus bekannt, bei 506 Patienten war eine Diabetes mellitus Erkrankung dokumentiert. 264 der 506 Patienten mit DM hatten laut Anamnese Metformin eingenommen und wurden in eine DM-mit-Metformin-Gruppe eingeteilt. 242 Probanden wurden einer Diabetes mellitus -ohne-Metformin-Gruppe zugeordnet.
In der Diabetes mellitus -ohne-Metformin-Gruppe hatten die Patienten einen signifikant niedrigeren BMI als die Patienten in der Diabetes mellitus -mit-Metformin-Gruppe (31,9 [9,4] vs. 34,0 [9,2], p=0,01) und der Anteil an Patienten, die Insulin anwendeten, war geringer (45,0% vs. 85,2%, p<0,001).
Die Prävalenz des Delirs in der DM-ohne-Metformin-Gruppe war mit 36,0% signifikant höher als in der DM-mit-Metformin-Gruppe (29,2%) (p = 0,048). Die frühere Einnahme von Metformin reduzierte das Risiko eines Delirs bei Patienten mit Diabetes mellitus (OR 0,50; 95%-Konfidenzintervall [KI]: 0,32 bis 0,79; nach der Kontrolle von beeinflussenden Faktoren).
Die Dreijahres-Mortalität war in der DM-ohne-Metformin-Gruppe (Überlebensrate 0,595 [95%-KI: 0,512 bis 0,669]) höher als in der DM-mit-Metformin-Gruppe (Überlebensrate 0,695; 95%-KI: 0,604 bis 0,770) (p = 0,035). Die frühere Einnahme von Metformin verringerte das Risiko, innerhalb von drei Jahren zu versterben (HR 0,69; 95%-KI: 0,48 bis 0,98; nach der Bereinigung um beeinflussende Faktoren).
Fazit
Anhand der hier vorgestellten Analysen fanden Wissenschaftler eine höhere Prävalenz von Delir und eine erhöhte Dreijahres-Mortalität bei Patienten mit Diabetes mellitus, die laut Anamnese kein Metformin eingenommen hatten, als bei Patienten ohne DM. Die Einnahme von Metformin kann das Risiko von Delir und Mortalität bei älteren Patienten senken, resümierten die Wissenschaftler.
Die Autoren benannten eine Reihe an Einschränkungen der Studie, unter anderem: Patienten, denen Metformin verschrieben wurde, könnten dies nicht eingenommen haben, und andererseits könnten Patienten, denen außerhalb des Krankenhausnetzwerks Metformin verschrieben wurde, fälschlicherweise als Metformin-negativ eingestuft worden sein. Die Metformindosis und die Dauer der Einnahme wurden ebenso nicht berücksichtigt.
Es wurden außer Insulin keine anderen antidiabetischen Medikamente in den Untersuchungen berücksichtigt, da wiederholt berichtet wurde, dass andere antidiabetische Medikamente im Vergleich zu Metformin keinen Nutzen für die Mortalität zeigten. Bewertungen für Demenz und Delir wurden nur zum Zeitpunkt der Rekrutierung und nicht während der dreijährigen Nachbeobachtungszeit durchgeführt. Weiterhin basierte die Bewertung des Delirs nicht auf dem psychiatrischen Goldstandard, den im DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fünfte Auflage) festgelegten Kriterien.
Der in diesem Bericht beobachtete Zusammenhang zwischen DM und Delir selbst war nicht neu, erklärten die Autoren. Jedoch wurde in dieser Studie zum ersten Mal eine potenzielle präventive Rolle von Metformin im Zusammenhang mit Delir gezeigt, ordneten die Wissenschaftler ihre Daten ein. Ob Patienten mit einem Risiko für ein Delir, zum Beispiel durch eine größere bevorstehende Operation, Metformin auch nur für kurze Zeit präoperativ und postoperativ einnehmen sollten, sollte durch zukünftige klinische Studien beantwortet werden, um möglicherweise die Patientenversorgung zu verbessern, meinten die Autoren. Insbesondere sollten auch die langfristigen Auswirkungen von Metformin auf Delir und Demenz in prospektiven klinischen Studien bewertet werden.









