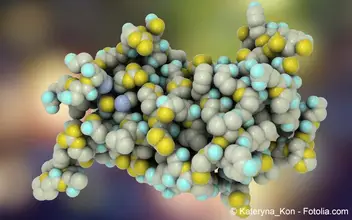Jede Zelle des menschlichen Körpers hat eine Art eigene Uhr. Diese richtet sich nach dem Zelltyp und dem, was im und mit dem Körper gerade passiert. Das betrifft den Stoffwechsel, die Hormonproduktion, das Immunsystem, das Verhalten und vieles mehr. Damit der Körper als Ganzes funktioniert, müssen diese Uhren fein aufeinander eingestellt werden. Gerät diese Homöostase durcheinander und das zirkadiane Zusammenspiel im Körper aus dem Takt, können metabolische Erkrankungen bis hin zu Krebs entstehen.
Das Mastermind im Körper ist der Nucleus suprachiasmaticus im Hypothalamus. Er verarbeitet Lichtimpulse der Umwelt und sorgt dafür, dass unsere inneren Uhren mit dem äußeren Licht als Hauptzeitgeber synchronisiert werden. Dadurch können Rhythmen fernab des Tageslichts tief in unserem Körper ständig aktualisiert und angepasst werden. Ohne diese Orchestrierung würden unsere Zellen frei laufen und irgendwann möglicherweise gegeneinander arbeiten statt mit- und füreinander.
Neben dem Licht gibt es aber auch andere Zeitgeber, die sich auf den Stoffwechsel und indirekt auch auf die Genexpression auswirken können. Essen und Sport können solche Zeitgeber sein. Auch sie unterliegen häufig rhythmischen Kontrollen, können sich aber selbst auch auf Krankheitsverläufe, den Blutzucker, die glykämische Kontrolle und Gewichtsverlust beispielsweise bei Typ 2 Diabetes mellitus oder Übergewicht auswirken. Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass bestimmte Nahrungsmittel zu manchen Tageszeiten mehr ansetzen als zu anderen. Ebenso wird seit Jahren vor allem Frühsport propagiert. Wie das Ganze jedoch auf zellulärer Ebene aussieht und wie sich gerade Sport auf den Stoffwechsel der verschiedenen Körperzellen und Organe auswirkt, darüber ist wenig bekannt. Dabei könnte gerade das entscheidend sein, wenn es um die Frage geht, wann beispielsweise übergewichtige Menschen Sport treiben sollten, um ihr Gewicht effektiver zu reduzieren. Ein Forscherteam aus Deutschland, Dänemark, Schweden, den Niederlanden und der USA hat sich deshalb nun mit dem Stoffwechsel verschiedener Organe und Zellen im Kontext zirkadianer Rhythmen befasst. Herausgekommen ist ein Atlas des Bewegungsstoffwechsels. Die Ergebnisse dieses Grundlagenforschungsprojekts wurden im Journal »Cell Metabolism« publiziert.
Zielsetzung
Untersucht werden sollte mit dem Forschungsvorhaben, wie sich Training auf verschiedene Gewebe im Körper auswirkt. Unterscheiden sich die gewebespezifischen metabolischen Adaptationen abhängig vom Trainingszeitpunkt? Wie wirkt sich das Training systemweit auf die Koordination zwischen den verschiedenen Geweben im Körper aus? Die Beantwortung dieser Fragen war Ziel des internationalen Projektes.
Methodik
Für die präklinische Studie wurden Mäuse im Labor in klassischen 12-Stunden-Zyklen mit 12 Stunden Helligkeit und 12 Stunden Dunkelheit bei konstanten 22°C (1°C Abweichung) gehalten. Gefüttert wurden die Tiere ad libitum mit klassischem Laborfutter.
Im Alter von 10 bis 11 Wochen teilte das Team die Tiere in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe erhielt Trainingseinheiten, die andere Gruppe eine Pseudo-Trainingseinheit. Die beiden Gruppen wurden jeweils in zwei Untergruppen unterteilt. Eine Untergruppe erhielt entweder eine Trainingseinheit oder eine Pseudotrainingseinheit in der frühen Ruhephase (ZT3), die andere Gruppe in der frühen Aktivitätsphase (ZT15). Die Tiere wurden also entweder am frühen Morgen oder am frühen Abend trainiert. Dafür wurden sie für jeweils eine Stunde auf ein Laufband gesetzt. In der Pseudotrainingsgruppe handelte es sich um ein stehendes Laufband, auf dem die Tiere für eine Stunde saßen.
Zu den Zeitpunkten 0, 4, 8, 12, 16 und 20 Stunden nach der jeweils einstündigen Trainings- bzw. Pseudotrainingseinheit, wurden den Tieren unter genereller Anästhesie mit Isofluran Gewebeproben aus Skelettmuskeln und Leber entnommen. Zusätzlich wurden sofort nach der einstündigen Einheit Proben aus Serum, Herz, Hypothalamus, epididymalem weißem Fettgewebe (eWAT), inguinalem weißem Fettgewebe (iWAT) und braunem Fettgewebe (BAT) entnommen. Arteriovenöses Blut wurde an den hinteren Gliedmaßen direkt aus Skelettmuskeln entnommen sowie unter anderem aus den Portalvenen, der Vena cava inferior und der Leber.
Alle Proben wurden mittels verschiedener Techniken auf Stoffwechselprodukte und Genaktivität hin untersucht. Dazu zählten Metabolomics-Analysen, targeted Gaschromatographische Massenspektrometrie, real-time qPCR, Western Blot und weitere. Die Daten wurden statistisch unter anderem mittels Heatmaps ausgewertet.
Ergebnisse
Die Ergebnisse der präklinischen Studie zeigte deutliche Unterschiede zwischen den zwei Trainingszeitpunkten ZT3 am frühen Morgen und ZT15 am frühen Abend. Insgesamt wurden ca. 550 bis 800 Metaboliten identifiziert, von denen 289 in allen Geweben und im Serum vorkamen. In jedem Gewebe wurde eine einzigartige metabolische Antwort gemessen, die abhängig war von der jeweiligen Trainingszeit. Die Auswirkungen des Trainings auf die Metaboliten waren zeit- und gewebeabhängig.
Beim Trainingszeitpunkt ZT15 waren 197 Metaboliten in den Muskeln verändert, bei ZT3 nur 52. Von diesen Metaboliten wurden 31 zu beiden Zeitpunkten gemessen. In der Leber waren es 129 Metaboliten bei ZT3 und 143 bei ZT15 (101 zu beiden Zeitpunkten). Auch im Serum, Herz, Hypothalamus, iWAT und BAT war die Trainingsantwort zum Zeitpunkt ZT15 am größten. Ähnlich verhielt es sich mit den Nukleotiden in Muskel, Leber und BAT sowie den Leberkohlenhydraten. Im eWAT war sie bei ZT3 generell reduziert, bei ZT15 aber deutlich angestiegen. Auch Aminosäuren und Fette zeigten eine stärkere Veränderung beim Trainingszeitpunkt ZT15. In der Leber jedoch waren die Auswirkungen jedoch bei ZT3 auf selbige am größten. Corticosteron hingegen zeigte ein gemischtes Profil. Es war der Hauptmetabolit und nach dem Training in allen Geweben erhöht, am stärksten aber vor allem bei ZT3 in Muskel, Herz, Hypothalamus, eWAT, iWAT und BAT, während vor allem in der Leber die von Glykogen abstammenden Metaboliten Maltopentaose, Maltotetraose und Maltotriose zum Trainingszeitpunkt ZT3 am stärksten abfielen, während der gleiche Effekt bei der Glukose bei ZT15 beobachtet wurde.
Anders verhielt es sich mit anderen Metaboliten: Ketonkörper wie beta-Hydroxybutyrat und Urea beispielsweise stiegen stärker in der ZT15-Trainingsgruppe an. Das deutet, so das Forscherteam, darauf hin, dass hier eine größere Abhängigkeit von der Fettsäureoxidation besteht und in der frühen Aktivitätsphase mehr gegen metabolischen Stress gepuffert werden kann. Auch hypothalamische Neurotransmitter stiegen in dieser Phase mehr an: Serotonin, Dopamin und der Metabolit Homovanillinsäure waren vor allem bei ZT15 erhöht.
Effekt auf metabolische Signalwege
Die Trainingseinheiten wirkten sich auch auf die metabolischen Signalwege unterschiedlich aus, je nach Zeitpunkt des Trainings. Während eine späte Trainingseinheit (ZT15) sich allgemein auf Signalwege auswirkte, die am Nukleotid- und Aminosäurenmetabolismus beteiligt sind und die Biosynthese von ungesättigten Fettsäuren vor allem im eWAT und iWAT mutmaßlich erhöht war, waren der Fettsäure- und der Kohlenhydratmetabolismus in der Leber vor allem nach einem frühen Training (ZT3) erhöht. Beim Glykogengehalt war es andersherum: Beim späten Training waren sowohl Glykogen als auch Glykolysemetaboliten in den Muskeln erniedrigt, in der Leber hingegen nicht. Das, vermutet das Studienteam, liegt an einer erhöhten Glykolyse in den Muskeln beim Training.
Ähnliches stellte das Team bei den Aminosäuren und Lipiden fest: Während in der Leber viele Aminosäuremetabolite sowohl nach einem frühen als auch nach einem späten Training erhöht waren, waren sie es im Serum nur bei ZT15. Das könnte auf einen erhöhten Abbau von Proteinen hindeuten und darauf, dass bei einem späten Training vermehrt Aminosäuren gebraucht werden. Auch der Lipidstoffwechsel verhielt sich konträr: Während in der Leber vor allem bei einem frühen Training (ZT3) die Lipolyse angekurbelt wurde, war es im weißen Fettgewebe und im Muskelgewebe nach einem späten Training.
Kommunikation zwischen den Geweben
Physisches Training wirkt sich nicht nur auf die Gewebe selbst aus, sondern auch auf die Kommunikation zwischen den verschiedenen Geweben. Besonders ein späteres Training bei ZT15 beeinflusste die Koordination zwischen der Leber und den Muskeln. Zu diesem Zeitpunkt nahm die Leber weniger Aminosäuren, Lipide, Nukleotide, Kohlenhydrate und andere Stoffwechselprodukte auf als bei ZT3. Gleichzeitig waren die Muskeln vor allem Net-Importeure von Aminosäuren, Lipiden, Kohlenhydraten, Nukleotiden und anderen Metaboliten des Energiestoffwechsels. Kohlenhydrate nahmen sie jedoch vor allem nach einer frühen Trainingseinheit (ZT3) auf. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass bei einem späteren Trainingszeitpunkt bereits weniger Glukose in den Muskeln und der Leber vorhanden sein könnte. In dem Fall würde die Lipolyse im weißen Fettgewebe aktiviert, im Körper Ketonkörper metabolisiert und Aminosäuren während des Trainings abgebaut - auch, weil weniger Glykogen in der Leber vorhanden ist, das den Skelettmuskeln als Energiequelle zur Verfügung gestellt werden könnte.
Damit diese Stoffwechselrhythmen funktionieren, müssen die verschiedenen Gewebe miteinander kommunizieren. Ein mögliches Exerkin, das an dieser Kommunikation beteiligt sein könnte, ist das 2-Hydroxyisobutyrat. Als mögliches Exerkin wird es deshalb bezeichnet, da es bei einer frühen Trainingseinheit etwa zweimal so viel nach dem Training ausgeschüttet wird, bei einer späten Trainingseinheit sogar drei- bis fünfmal so viel. Wurde es den Tieren in der Studie injiziert, wurde der Energieverbrauch vorübergehend für ca. 30 Minuten unterdrückt und der Blutzucker stieg sowohl bei ZT3 als auch ZT15 für ca. 60 Minuten an. Das erhärtet den Verdacht, dass 2-Hydroxyisobutyrat ein systemisches Exerkin ist, weiter, denn es scheint den Energieverbrauch mitzuregulieren und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Geweben weiter zu stabilisieren.
Fazit
Mit der Studie ist es dem Team gelungen, einen Atlas des Bewegungsstoffwechsels, abhängig von der Tageszeit, zu erstellen. Dieser Atlas gibt Informationen darüber, wann welche Stoffwechselprodukte in den jeweiligen Geweben ausgeschüttet werden. Gleichzeitig informiert er darüber, zu welchem Trainingszeitpunkt welcher Stoffwechsel aktiv ist und wie die verschiedenen Gewebe miteinander kommunizieren können.
„Dies ist die erste Studie, die den Stoffwechsel in Abhängigkeit von Bewegung und Tageszeit über mehrere Gewebe hinweg beschreibt. Wir verstehen jetzt besser, wie Bewegung gestörte zirkadiane Rhythmen, die mit Adipositas und Typ-2-Diabetes in Verbindung stehen, neu ausrichten kann. Unsere Ergebnisse werden neue Studien ermöglichen, die den richtigen Zeitpunkt körperlicher Belastung für Therapien und die Prävention von Krankheiten erforschen“, sagt Dominik Lutter, der die Studie seitens Helmholtz Munich leitete und sowohl am Helmholtz Diabetes Center als auch beim Deutschen Zentrum für Diabetesforschung (DZD) forscht. Aufbauend auf diesen Ergebnissen kann nun in weiteren Studien untersucht werden, welche Trainingszeiten beim Menschen helfen können, aus dem Takt geratene Uhren in den Muskeln neu einzustellen und den Stoffwechsel neu zu justieren.