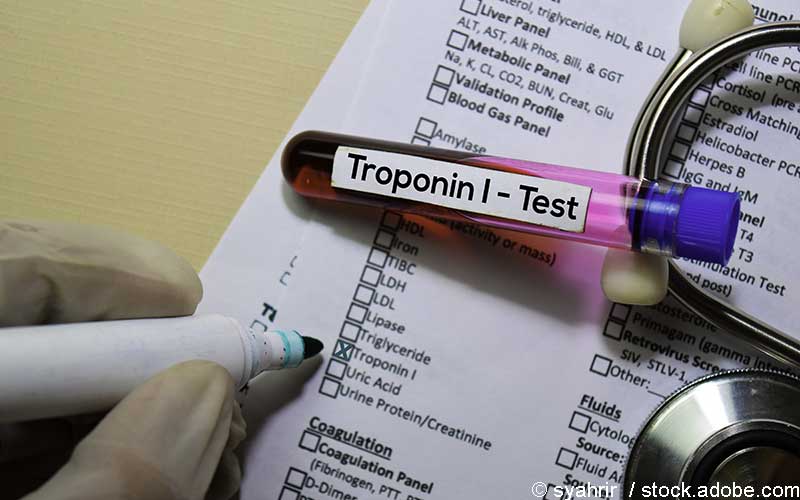
Hintergrund
Herzinsuffizienz (heart failure [HF]) ist bis heute die häufigste Ursache von Mortalität und Morbidität in der westlichen Welt und wird voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter deutlich ansteigen.
Eine primäre Prävention ist ein bisher unerreichtes Ziel und auch eine Biomarker-basierte Diagnostik zur Früherkennung und Risikoprognose einer Herzinsuffizienz ist bis heute begrenzt und wird selten angewendet.
Einer der Biomarker ist NT-proBNP (N-terminal pro-B-type natiuretic peptide). Er findet sowohl Anwendung in der Diagnostik sowie als prognostischer Faktor. Neben NT-proBNP ist das kardiale Troponin der aktuell bedeutendste kardiologische Biomarker und dient als Goldstandard für Myokardschädigungen. Neue Assays für hs-cTn (high-sensitivity cardiac troponin) ermöglichen nun auch eine Anwendung als prognostischer Biomarker, da eine Bestimmung auch bei sehr niedrigen Konzentrationen möglich ist. Erste Studien zeigen, dass mit den neuartigen hs-cTn-Assays eine abgestufte und unabhängige Assoziation zur Inzidenz der Herzinsuffizienz möglich ist.
Zielsetzung
Das Ziel dieser prospektiven Kohortenstudie war es einen Nachweis zu erbringen, dass es eine Assoziation zwischen dem kardialen Biomarker hs-cTnI und dem Auftreten einer Herzinsuffizienz in der allgemeinen Bevölkerung gibt. Weiterhin sollte der prädiktive Wert über die Anwendung als klassischer kardiovaskulärer Risikofaktor hinaus bestimmt werden, um einen relevanten Grenzwert für potenzielle klinische Anwendungen zu erhalten. Das BiomarCaRE Konsortium hat sich zum Ziel gesetzt, den Wert von etablierten und neu entdeckten Biomarkern zu bestimmen, um eine verbesserte Risikovorhersage von kardiovaskulären Erkrankungen in Europa zu erhalten.
Methodik
Um eine verbesserte Risikovorhersage von kardiovaskulären Erkrankungen in Europa zu erhalten wurden in groß angelegten epidemiologischen Kohorten über einen langen Nachbeobachtungszeitraum Daten zu kardiovaskulären Erkrankungen und deren epidemiologischen und klinischen Phänotypen ge sammelt.Die Analyse dieser Studie basiert auf den Daten von vier Bevölkerung-basierten Kohorten aus Dänemark, Finnland, Italien und Schweden. Als Studienteilnehmer wurden Probanden eingeschlossen, die keine kardiovaskulären Erkrankungen inklusive Herzinsuffizienz, Myokardinfarkt oder Schlaganfall hatten. Als primärer Endpunkt wurde das Auftreten einer Herzinsuffizienz definiert. Es wurden routinemäßige klinische Diagnosen und die Todesursachen von Sterbeurkunden dokumentiert.
Ergebnisse
Allgemeine Daten zur Studienpopulation
Insgesamt konnten 48.455 Probanden aus den vier Kohorten in die statistische Analyse eingeschlossen werden. Aus den ursprünglich 51.590 Studienteilnehmer wurden 2.735 aufgrund einer bestehenden Herzinsuffizienz, Myokardinfarkt und Schlaganfall ausgeschlossen.
- Das mediane Alter der Studienpopulation lag bei 50,7 Jahren und 25.134 (51,9%) Teilnehmer waren weiblichen Geschlechts.
- Die mediane Nachbeobachtungszeit betrug 6,61 Jahre (95%-Konfidenzintervall (KI): 6,55-6,66 Jahre).
- Eine Herzinsuffizienz entwickelten im Nachbeobachtungszeitraum 1.965 Studienteilnehmer (4,1%).
- Die Gesamtmortalität lag bei 9,6% (n = 4.648 Studienteilnehmer).
- Der mediane BMI lag bei 26,5 kg/m2, 43,8% litten unter Bluthochdruck und bei 4,6% der Studienpopulation wurde ein Diabetes diagnostiziert.
- Bei den Blutwerten lag der mediane LDL bei 3,3 mmol/, der HDL bei 1,4 mmol/l und das Gesamtcholesterin bei 5,6 mmol/l.
- Subgruppe der Herzinsuffizienz-Patienten:
- Das Auftreten eines Myokardinfarktes sowie die Gesamtmortalität war in dieser Subgruppe erhöht nach der Diagnosestellung. 29,4% erlitten einen Myokardinfarkt und die Gesamtmortalität betrug in dieser Subgruppe 45,4%.
- Das mediane Alter war mit 61,2 Jahren gegenüber der Gesamtpopulation erhöht und 57,2% waren männlichen Geschlechts.
- Alle kardiovaskulären Risikofaktoren sind in der HF-Subgruppe gegenüber der Gesamtpopulation erhöht. Hierzu zählen BMI, systolischer Blutdruck, Diabetes und Blutfettwerte.
Verteilung der Biomarker:
- Die mediane Konzentration von hs-cTnI lag bei 2,3 ng/l und für NT-proBNP bei 46,2 ng/l in der Gesamtpopulation und bei der Subgruppe der HF-Patienten lag hs-cTnI bei 4,0 ng/l und NT-proBNP bei 102,5 ng/l.
- Zusammenhang von HF und hs-cTnI:
- Die Wahrscheinlichkeit einer HF steigt mit erhöhten hs-cTnI-Konzentrationen sowohl bei Frauen als auch bei Männern.
- Der größte Zusammenhang zwischen HF und hs-cTnI lag bei Probanden mit Konzentrationen von > 3,2 ng/l (Hazard Ratio (HR): 1,63; 95%-KI: 1,32-2,03; p < 0,001) und zwischen HF und NT-proBNP bei Konzentration von > 68,26 ng/l (HR: 2,48; 95%-KI:2,02-3,03; p < 0,001). - hs-cTnI und die Vorhersage von HF:
- Der beste Vorhersagewert konnte im Modell mit allen kardiovaskulären Risikofaktoren (Basismodell) und beiden Biomarkern gefunden werden (C-Index = 0,862; 95%-KI: 0,841-0,882).
- Der optimale Anhaltswert von hs-cTnI für das individuelle Risiko einer HF lag bei 2,6 ng/l für Frauen und 4,2 ng/l für Männer. Eine potenzielle präventive Therapie sollte bei diesen Werten in Betracht gezogen werden.
Fazit
Die groß angelegte Kohortenstudie konnte zeigen, dass der Biomarker hs-cTnI als unabhängiger Prognosefaktor einer Herzinsuffizienz verwendet werden kann. Der beste Vorhersagewert für eine Herzinsuffizienz wird jedoch durch die Kombination der beiden Biomarker hs-cTnI und NT-proBNP erreicht. Die Verwendung der beiden Biomarker zur Prognose der Risikowahrscheinlichkeit einer Herzinsuffizienz kann bei zukünftigen klinischen Entscheidungen immer mehr an Bedeutung gewinnen.










